Ausnahmezustand als Normalfall
Die Schweiz am Schalter
Ein Jahr nach dem UN-Zukunftsgipfel: Wie Bern, Genf, Basel und Zürich in die Notstands-Architektur verdrahtet werden
Dieser Artikel basiert auf einem hervorragenden, aber sehr langen Substack-Beitrag von Escape Key. Wir haben das Wichtigste daraus für die Schweiz aufbereitet und zusammengefasst.
Vor einem Jahr wurde am UN-“Summit of the Future“ der Pact for the Future beschlossen. Offiziell sollte er Frieden, Nachhaltigkeit und Solidarität fördern. Doch ein Jahr später sehen wir davon nichts: weder Frieden in der Ukraine noch Solidarität in Gaza. In der Realität markierte dieser Beschluss lediglich den Startschuss für eine neue Notstandsarchitektur (nur um das geht es): die UN Emergency Platform. Dieses Konstrukt schafft keine neuen Institutionen, sondern schaltet bei globalen Schocks bestehende Hebel zusammen: Finanzströme, Standards, digitale Ausweise, Beschaffungsrichtlinien. So wird aus Krisenmanagement ein Dauer-Notstand, der auf Knopfdruck aktiviert werden kann.
Die lange Vorgeschichte: Von der Clearing-House-Logik zur Emergency Platform
Geschichte ist meist mehr, als uns an Geschichten in der Schule oder in den systemtreuen Medien erzählt wird. Aber genau diese Geschichte erklärt, wie wir heute hier gelandet sind.
Die DNA der Kontrolle: Clearing House-Logik (1770er)
Das Londoner Bankers’ Clearing House wurde in den 1770er-Jahren gegründet, um den Zahlungsverkehr zwischen Banken effizienter zu machen. Die Idee war einfach: Anstatt, dass jede Bank mit jeder anderen einzeln abrechnet, gab es eine zentrale Stelle, die Forderungen und Schulden miteinander verrechnete. Für die Banken war das praktisch, aber es hatte einen Haken. Wer nicht mitmachte, war sofort im Nachteil. Die Teilnahme war offiziell freiwillig, doch in der Praxis bedeutete ein Ausschluss den sicheren Bankrott.
So entstand eine unsichtbare Form der Kontrolle: nicht durch offene Gewalt oder Gesetze, sondern durch die Abhängigkeit von einer Infrastruktur. Einmal etabliert, konnte sich kaum jemand leisten, draussen zu bleiben. Genau dieses Prinzip, Infrastrukturabhängigkeit statt direkter Zwang, wurde zur Blaupause für spätere Machtmechanismen.
Ideologische Verpackung:
Sozialismus light & „Gerechtigkeit“ (ab 1890er)
Ende des 19. Jahrhunderts brauchte dieses Prinzip eine moralische Verpackung. Der deutsche Sozialdemokrat Eduard Bernstein entwickelte seine Theorie der “evolutionären“ oder „reformistischen“ Transformation. Statt Revolution predigte er den langsamen Umbau: Schritt für Schritt sollten Institutionen und Gesetze so verändert werden, dass die Gesellschaft “gerechter“ wird. Unterstützt wurde er von der Fabian Society in England, einem Kreis einflussreicher Intellektueller, die an den langen Hebeln der Bürokratie und Politik zogen. Parallel entstand der Guild Socialism mit Denkern wie Arthur Penty, G.D.H. Cole und Leonard Woolf. Ihre Grundidee: Macht sollte nicht mehr bei Wählern oder Parlamenten liegen, sondern bei “Funktionsträgern“, also Experten, die bestimmte Bereiche technisch verwalten. Erst in Betrieben und Verbänden, später auf nationaler Ebene und schliesslich international.
So verschob sich das Zentrum politischer Entscheidungen von demokratischen Wahlen hin zu fachlich legitimierten Gremien.
Mit der Begründung, es gehe um Effizienz und Gerechtigkeit, wurde die Demokratie Stück für Stück durch funktionale Institutionen ersetzt. Erst im Kleinen, dann im Grossen.
Institutionelle Kontinuität:
League of Nations, dann UN (1919–1945)
Nach dem Ersten Weltkrieg stand die Welt vor der Frage, wie sich neue Katastrophen verhindern lassen. Die Antwort der Sieger lautete: eine internationale Organisation, die nicht nur Diplomatie betreibt, sondern auch technische Aufgaben übernimmt. Alfred Zimmern, ein britischer Historiker und Politikwissenschaftler, prägte dabei entscheidend das Konzept. Seine Überzeugung war: Dauerhafter Frieden könne nicht allein durch politische Abkommen gesichert werden, sondern müsse durch wirtschaftliche und soziale Koordination entstehen. Mit anderen Worten: Ökonomie wurde zum Vehikel für “soziale Gerechtigkeit“ und internationale Stabilität erklärt.
Die League of Nations, der Völkerbund, schuf deshalb nicht nur ein Forum für Staatenlenker, sondern baute sofort ein Netz von technischen Organisationen auf, für Gesundheit, Arbeit, Handel, Kommunikation. Diese spezialisierten Institutionen arbeiteten scheinbar neutral und fachlich, hatten aber de facto grossen Einfluss darauf, wie Staaten ihre Gesetze und Standards gestalten mussten. Was damals als Fortschritt gefeiert wurde, war in Wahrheit die Etablierung einer funktionalen Steuerungsebene oberhalb der nationalen Politik.
Als die League scheiterte und nach dem Zweiten Weltkrieg die UN gegründet wurde, blieb dieses technische Gerüst praktisch unangetastet bestehen. Die UNO übernahm die Strukturen 1:1:
- Der Sicherheitsrat (UNSC) wurde zur Exekutive mit bindenden Beschlüssen.
- Der Wirtschafts- und Sozialrat (ECOSOC) wurde zum Verwaltungsgehirn, das Organisationen wie WHO, ILO oder UNESCO koordiniert.
- Und über die Akkreditierung von NGOs stellte man sicher, dass nur die “brave“ Zivilgesellschaft einen Sitz am Tisch bekam. Kritische oder unberechenbare Stimmen blieben draussen. Das Ergebnis: ein “manufactured consensus“, ein künstlich hergestellter Konsens, der von Anfang an ins System eingebaut war.
Schlüsselereignisse ab 1990
Mit dem Ende des Kalten Krieges öffnete sich die Tür, um diesen Mechanismus auszuweiten:
- Resolution 47/60 (1992): Sie dehnte den Begriff von „Frieden und Sicherheit“ erstmals explizit auf Umwelt, Gesundheit und Wirtschaft aus. Damit war der Türöffner geschaffen, jede Art von Krise in den Zuständigkeitsbereich der UN zu ziehen.
- HIV/AIDS als Sicherheitsrisiko (2000): Zum ersten Mal wurde eine Krankheit als globale Sicherheitsgefahr eingestuft. Das führte zur Globalisierung der Gesundheitsüberwachung.
- Ebola als Sicherheitsrisiko (2014): Die WHO und die UN traten offen als eine Art Weltfeuerwehr auf. Militärische und zivile Strukturen wurden kombiniert, um ein Virus wie eine Bedrohung für die internationale Sicherheit zu behandeln.
- Seitdem gilt: Jede Krise, ob Gesundheits-, Klima- oder Wirtschaftsschock, kann zum Fall für den Sicherheitsrat werden. Die Schwelle ist gefallen, die Logik etabliert.
Emergency Platform: Der Schalter (2023–2025)
Auf der Emergency Platform (Notfallplattform) ist von „cross-border, cross-domain shock“ die Rede, also von Störungen, die Grenzen überschreiten und mehrere Bereiche betreffen. Klingt technisch, bedeutet aber:
Praktisch jede Krise kann hineinpassen. Eine Pandemie, ein Hackerangriff, eine Finanzpanik, extreme Wetterereignisse oder auch soziale Unruhen, alles lässt sich als grenzüberschreitender Schock mit Folgewirkungen darstellen. Genau diese Dehnbarkeit sorgt dafür, dass es keine klare Grenze gibt, ab wann die Plattform greift.
Besonders heikel ist die Rolle von Modellen und Frühwarnsystemen. Black-Box-Algorithmen, die kaum jemand durchschaut, können bereits als Auslöser dienen. Wenn ein Modell zeigt, dass eine bestimmte Entwicklung “wahrscheinlich“ gefährlich wird, reicht das, um den Notfallmodus zu aktivieren. Mit anderen Worten: Es muss gar nicht erst etwas passieren, die Prognose genügt. Die Legitimation kommt nicht aus demokratischer Debatte, sondern aus statistischen Berechnungen, die als objektiv und alternativlos dargestellt werden.
Einmal ausgelöst, läuft die Verlängerung des Notstands praktisch automatisch. Es gibt keine eingebaute Veto-Bremse mehr, die wie früher blockieren könnte. Wo früher der Sicherheitsrat mit den Vetorechten der Grossmächte zumindest formale Hürden bot, sorgt die Emergency Platform für einen Dauerbetrieb im Ausnahmezustand. Der Schalter wird nicht nur umgelegt, er bleibt auch eingerastet. Damit verschiebt sich die Logik des Regierens: von zeitlich begrenzten Notfällen zu einem permanenten Krisenmodus, in dem Ausnahmeregeln die Normalität werden
Die Schweiz als Drehscheibe
Viele Menschen in der Schweiz glauben noch immer, unser Land könne sich solchen Entwicklungen entziehen. Die vermeintliche Neutralität, direkte Demokratie und eine gewisse politische Sonderstellung werden oft als Schutzschild betrachtet. Doch die Realität sieht inzwischen ganz anders aus:
Die Schweiz ist nicht Randfigur, sondern ein zentraler Knotenpunkt dieser Notstandsarchitektur. Die entscheidenden Schaltstellen liegen direkt bei uns, geografisch wie institutionell.
Genf zum Beispiel beherbergt gleich mehrere der wichtigsten internationalen Organisationen: die WHO, die WTO, die ILO und die WIPO. All diese Institutionen sind keine Randnotizen, sondern die eigentlichen Werkzeuge, die im Notstandsmodus aktiviert werden. Von der öffentlichen Gesundheit über den Welthandel bis hin zu Arbeits- und Urheberrechten, in Genf laufen die globalen Fäden zusammen. Neutralität hin oder her: Wer diese Organisationen vor der Haustür hat, ist automatisch Teil des Systems.
Basel wiederum ist die Heimat der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, kurz BIZ. Sie wird oft als “Zentralbank der Zentralbanken“ bezeichnet. Hier werden die Kapitalflüsse koordiniert und Standards gesetzt, die weltweit Gültigkeit erlangen. Wenn internationale Vorgaben über die Finanzmärkte durchgesetzt werden, führt kein Weg an Basel vorbei. Mit ESG-Kriterien, Nachhaltigkeitsstandards und Klimaszenarien wird hier entschieden, wohin das Geld fliesst und wohin nicht. Damit ist Basel ein zentraler Hebel, um Compliance zu erzwingen.
Zürich spielt als Versicherungsdrehscheibe eine ganz eigene Rolle. Die Stadt ist Heimat eines der grössten Rückversicherer der Welt. Dort wird Risikosteuerung betrieben, und genau hier greifen internationale Vorgaben besonders schnell. Denn wenn Policen oder Rückversicherungsverträge künftig nur noch an bestimmte Standards oder Zertifikate gekoppelt werden, sitzt Zürich direkt an der Schaltstelle. Ohne passende Nachweise gibt es keine Absicherung mehr. Was wie eine technische Frage aussieht, wird damit zu einem harten Durchsetzungsinstrument.
Und schliesslich Bern: Die Politik hat bei der Revision der Internationalen Gesundheitsvorschriften keinen Vorbehalt eingelegt. Das bedeutet, dass die Schweiz akzeptiert hat, dass Notstandskompetenzen künftig direkt über die WHO auch unser Land betreffen. In der Praxis heisst das: Wenn die WHO eine bestimmte Krise zum internationalen Gesundheitsnotstand erklärt, ist die Schweiz automatisch gebunden, ohne Möglichkeit, sich einfach herauszuhalten. Mit diesem Schritt hat Bern die letzte nationale Bremse freiwillig gelöst.
All das zeigt: Die Schweiz ist kein unbeteiligter Beobachter, der sich bequem aus globalen Machtspielen heraushalten kann. Sie ist integraler Bestandteil mit Genf als Agenturhafen, Basel als Finanzmotor, Zürich als Versicherungsknoten und Bern als politischem Türöffner. Wer glaubt, wir könnten uns entziehen, verkennt die Realität.
Schweizer Realität: IGV, E-ID und Epidemiengesetz
Am 19. September 2025 treten in der Schweiz die revidierten Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV) in Kraft. Damit akzeptiert Bern offiziell, dass die WHO künftig im Krisenfall weitreichende Kompetenzen über unser Land hat. Was auf dem Papier wie Empfehlungen aussieht, verwandelt sich in der Praxis in de-facto-Pflichten. Denn sobald Finanzierungen, internationale Beschaffungsregeln oder Mobilitätsstandards an diese Empfehlungen gekoppelt sind, kann sich die Schweiz nicht mehr entziehen. Ein formales Opting-out (Widerspruch) wäre möglich gewesen, doch Bern hat bewusst darauf verzichtet.
Parallel dazu läuft die Einführung der E-ID, die den Alltag für Bürger und Verwaltung angeblich vereinfachen soll. In Wirklichkeit wird sie zur zentralen Schlüsselinfrastruktur, über die praktisch alles abgewickelt wird: Zugang zu Verwaltungsdiensten, Banken, Versicherungen und Gesundheitssystemen. Mit der E-ID entsteht eine digitale Schnittstelle, die jederzeit mit internationalen Regelwerken verknüpft werden kann. Sobald globale Krisenregeln greifen, landen sie direkt bei den Bürgern, nicht über den Umweg von Parlament oder Volksabstimmung, sondern technisch eingebettet in den digitalen Identitätsausweis. Ein einziges Häkchen entscheidet dann, wer teilnimmt und wer ausgeschlossen bleibt. Das reicht von der Einreise bis hin zum Zugang zu Leistungen oder Zahlungsdiensten.
Hinzu kommt die geplante Teilrevision des Epidemiengesetzes. Offiziell soll sie die Lehren aus der Corona-Pandemie ziehen. Tatsächlich aber verschiebt sie Kompetenzen weiter nach oben und bindet nationale Entscheidungsprozesse noch enger an internationale Vorgaben. Dadurch wird das Parlament faktisch entmachtet, weil es im Krisenfall kaum noch Gestaltungsspielraum hat. Internationale Standards und WHO-Empfehlungen setzen sich automatisch durch, während nationale Behörden vor allem noch für die Umsetzung verantwortlich sind.
Aus all dem ergibt sich ein Dreiklang: erstens internationale Notstandsregeln über die IGV, zweitens nationale Rechtsanpassung durch die Teilrevision des Epidemiengesetzes und drittens die technische Umsetzung via E-ID. Zusammengenommen bilden sie die direkte Anschlussstelle der Schweiz an die globale Notstandsarchitektur.
Was wie drei voneinander getrennte Entwicklungen wirkt, fügt sich nahtlos ineinander. Genau an diesem Punkt wird sichtbar, dass die Schweiz nicht nur Standort, sondern integraler Bestandteil eines Systems ist, das auf Dauerbetrieb im Ausnahmezustand programmiert ist.
Schweizer Pointe
Während uns 20 Minuten vor der bösen Bettflasche warnt und das BAG gleichzeitig weiterhin fleissig die toxischen COVID-Spritzen empfiehlt, läuft im Hintergrund unbeirrt die Agenda weiter. Ironischer könnte es kaum sein: Auf der Vorderbühne kleine Ablenkungen, auf der Hinterbühne wird das Notstandsnetz engmaschig verdrahtet.
Und dann sehen wir unsere UN-Botschafterin Pascale Baeriswyl im Fernsehen, wo sie mit Grabesernst globale Floskeln herunterbetet über Kriege, Hungersnöte, erratische Zölle und autoritäre Regime. Alles wichtig, zweifellos. Nur das Wesentliche fehlt: Dass die UNO selbst längst ein Notstandsarchitekt ist, dessen Schalter schon bereitsteht. Über dieses Treiben schweigt sie lieber.
Die Pointe: Während Baeriswyl und Co. die Weltlage “einordnen“, wird die Schweiz im Hintergrund selbst eingeordnet und zwar in ein System, das Dauerkrise als Normalzustand vorsieht. Genf, Basel, Zürich und Bern liefern die Schaltstellen. Die schöne Rhetorik über Frieden, Solidarität und Neutralität ist bloss Kulisse. Die eigentliche Handlung findet im Maschinenraum statt, dort, wo kein Kamerateam hinschaut.
Quellen:
International:
- UN, Our Common Agenda (2021)
- UN Policy Brief: Emergency Platform (2023)
- UN, Pact for the Future (Summit of the Future, 22.09.2024)
- UN-Generalversammlung, Resolution 47/60 (1992) – Ausweitung von „Frieden & Sicherheit“
- UNSC-Resolution 1308 (2000) – HIV/AIDS als Sicherheitsrisiko
- UNSC-Resolution 2177 (2014) – Ebola als Sicherheitsrisiko
- BIZ/NGFS: Climate & ESG Standards (laufend)
National (Schweiz):
- WHO, Revision der Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV), Inkrafttreten in der Schweiz am 19.09.2025
- Bundesgesetz über elektronische Identifizierungsdienste (E-ID)
- Teilrevision Epidemiengesetz (EpG), in parlamentarischer Beratung
- Bundesrat / BAG: Mitteilungen zur IGV-Umsetzung (kein Vorbehalt eingelegt)


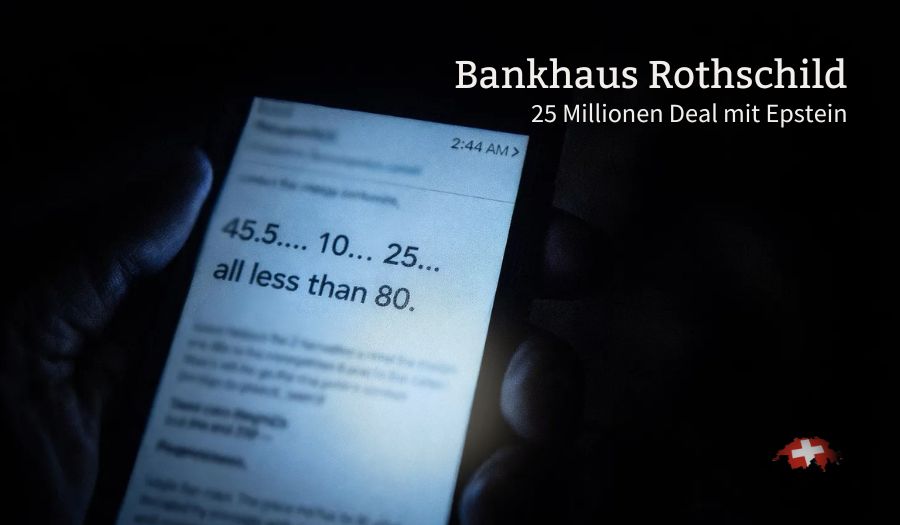







Danke für eure Unterstützung, ich bin von der Schweiz als meine Heimat restlos enttäuscht.
Im Militär haben wir schon einiges gesehen. Die Wahrheit wurde aber schon vor 30 Jahren nicht veröffentlicht oder diskutiert. Wir dachten es sei zu unserem Besten..
Der Bundesrat und – ich würde behaupten – der grössere Teil der National- sowie Ständeräte sind gekauft 🤔🤷
Ich glaube nicht mehr an Märchen, spätestens nach dem 9/11 oder Covid-19.
Macht weiter so 🤘🏽👍🍀