Bankenstabilität à la Bundesrat
Der Steuerzahler ist raus – der Sparer ist drin
Ein WIR-Kommentar zur Vernehmlassung zur Eigenkapitalunterlegung ausländischer Beteiligungen im Stammhaus von systemrelevanten Banken
Worum geht’s?
Wer uns kennt, den Schweizerischen Verein WIR, der weiss: Wir verkürzen unsere Lebenszeit nicht mit Vernehmlassungen und Antworten darauf. Normalerweise. Aber diesmal machen wir eine Ausnahme. Warum? Weil die UBS offenbar zum Nationalheiligtum erhoben wurde, irgendwo zwischen Halbtax-Abo und Käsefondue moitié-moitié.
Und wenn ein Heiligtum wackelt, wird schnell mit grossen Worten beruhigt: «Mehr Stabilität! Mehr Schutz!» Unser Problem: Diese Vorlage bringt keine echte Sicherheit, sondern eine Scheinsicherheit. Das nennen wir freundlich: Beruhigungspille.
Worum es wirklich geht: Der Bundesrat will, dass systemrelevante Banken (faktisch: die UBS) ihre Auslandsbeteiligungen im Stammhaus vollständig mit hartem Eigenkapital unterlegen. Klingt clever, ist aber: Kosmetik. Das Risiko bleibt, es wird nur umetikettiert. Der Steuerzahler ist draussen, aber der Bankkunde steht jetzt in der ersten Reihe.
Damit das jeder versteht, brechen wir es runter. Einfach, klar, ohne Zinszauber und Eigenkapital-Hokuspokus.
Der Schein der geprüften Sicherheit: Drei Gutachten, ein Ergebnis
Bevor der Bundesrat seine Vorlage veröffentlichte, liess er sich von drei «unabhängigen Experten» bestätigen, dass alles gut sei: BSS Volkswirtschaftliche Beratung AG, Alvarez & Marsal und Prof. Dr. Heinz Zimmermann von der Uni Basel. Drei Namen, ein Zweck: Beruhigung.
Kurz gesagt:
- BSS liefert das Etikett: «Effizient, zielgerichtet, tragbar.» Klingt gut, sagt aber nichts. Kein Wort über Kundenschutz oder Einlagensicherung.
- Alvarez & Marsal loben die Schweiz als «international führend». Ein diplomatischer Handschlag, kein Realitätscheck.
- Prof. Zimmermann sorgt für den akademischen Anstrich: Vertrauen, Puffer, Wettbewerb. Alles drin – ausser Substanz.
Drei Gutachten, ein Ergebnis: Stabilität auf dem Papier. Was keiner sagt: Wer wirklich verliert, wenn das Spiel schiefgeht.
Der Mythos Einlagensicherung – in Zahlen
Der Einlagensicherungsfonds (esisuisse) ist, gemessen an der Grösse der UBS, reine Symbolpolitik. Er könnte im Ernstfall nicht einmal einen Bruchteil der angeblich geschützten Guthaben absichern.
In der Schweiz sind Einlagen bis 100’000 Franken pro Kunde und pro Bank gesetzlich geschützt (Art. 37a BankG). Wer also mehrere Konten bei derselben Bank hat, bekommt im Krisenfall maximal 100’000 Franken insgesamt, nicht pro Konto. Zuständig ist der Verein esisuisse, mit einem Gesamtdeckel von 8 Milliarden Franken (Stand 2025).
Nach der Credit-Suisse-Übernahme 2023 hält die UBS rund 300 Milliarden Franken Kundeneinlagen in der Schweiz. Selbst wenn nur ein Teil davon unter die gesetzliche Schutzgrenze von 100’000 Franken pro Kunde fiele, könnte der Einlagensicherungsfonds mit seinen 8 Milliarden Franken kaum mehr als ein bis zwei Prozent davon abdecken. Es ist, als würde man versuchen, den Vierwaldstättersee mit einem Joghurtdeckel zu verschliessen.
Und das Beste: Das Geld ist gar nicht da. Die Banken müssen es erst im Krisenfall einzahlen, also dann, wenn sie selbst wackeln. Das ist kein Sicherheitsnetz, sondern ein Kettenversprechen. Wenn die UBS fällt, fällt auch das Vertrauen.
Offiziell ist ein Bail-out (= staatliche Bankenrettung mit Steuergeld) ausgeschlossen. Doch im Ernstfall gilt das nur, bis das Notrecht aktiviert wird, wie schon bei der Credit Suisse. Dann heisst es nicht mehr «Rettungspaket», sondern «Stabilisierungsfazilität». Gleicher Inhalt, neues Etikett.
Fazit: Der Bail-out ist nicht abgeschafft, sondern umbenannt. Und die Einlagensicherung? Ein psychologisches Instrument. Oder wie wir sagen: eine Versicherung, die nur gilt, solange sie keiner braucht.
100’000 Franken sind sicher, wenn du sie bei einer kleinen Regionalbank hast.
Bail-in vs. Bail-out: Wer zahlt wirklich?
Ein Bail-out heisst: Der Staat rettet die Bank mit Steuergeld. Ein Bail-in heisst: Gläubiger und Kunden über 100’000 Franken werden zur Kasse gebeten. Das steht so in den Unterlagen. Es heisst nur anders: «Bail-in-Bonds»: Anleihen, die im Krisenfall Verluste tragen.
Früher zahlte der Steuerzahler, heute der Kunde. Fortschritt?
Unsere Idee: «No-Bail» ohne SNB-Bürgerkonto
Wir haben keine Professur für Bank- und Risikomanagement, sind aber nicht ganz auf den Kopf gefallen (und auf jeden Fall selbsternannte Experten) und werfen einfach mal eine Idee in den Raum.
Weil sicher niemand von uns ein Transaktionskonto bei der SNB haben will, schlagen wir etwas anderes vor. Etwas, das funktioniert, ohne dass der Staat uns alle direkt an die Notenbank andocken muss.
Sicherheit entsteht, wenn Risiken dorthin kommen, wo sie hingehören: zu den Eigentümern, nicht zu den Sparern. Banken dürfen ihre Fehler nicht mehr auf die Gesellschaft abwälzen, und Sparer sollen nicht länger als unfreiwillige Haftungsmasse herhalten.
Unser Vorschlag ist einfach:
- Der Zahlungsverkehr muss unantastbar bleiben. Kundengelder sollen als treuhänderisches Sondervermögen behandelt werden, getrennt vom Eigenkapital der Bank.
- Diese Konten müssen zu 100 % mit Liquidität gedeckt sein. Heisst: Dein Geld bleibt deins, auch wenn die Bank wackelt.
- Kredite und Investitionen dürfen nur noch aus echtem Risikokapital finanziert werden. Wer Rendite will, trägt das Risiko.
- Bail-outs und Bail-ins müssen gesetzlich ausgeschlossen werden.
- Verluste werden über vertragliche Instrumente (CLT = Contractual Loss Transfer) getragen, also durch Investoren, die das Risiko freiwillig zeichnen.
Wenn eine Bank ins Wanken gerät, greifen automatische Sicherungsmechanismen. Die SNB bleibt Liquiditätsgeberin, nicht Retterin. Sie vergibt Kredite nur kurzfristig, voll besichert und zu Strafzinsen. Kein Gratisgeld für Zockerbanken. Und Manager haften persönlich.
Ergebnis: Keine Rettung, kein Haircut, kein Chaos. Nur klare Regeln, wer wann verliert.
Warum diese Lösung niemand will
- Weil das Geschäftsmodell der Banken darauf beruht, Risiko zu sozialisieren.
Wenn Banken Kredite nur noch aus echtem Risikokapital vergeben dürften, wären 80 % ihrer Gewinne weg. Keine Giralgeld-Schöpfung, kein Aufblasen der Bilanz, also das Ende ihres Machtmonopols. - Weil Politik und Aufsicht längst Komplizen sind.
Sie tun so, als hätten sie das System gezähmt («Too big to fail»), aber in Wahrheit haben sie es nur komplizierter gemacht. Solange alles stabil aussieht, ist für die Politik alles gut. - Weil die SNB selbst Teil des Problems ist.
Die Notenbank lebt davon, dass Banken sich bei ihr refinanzieren. Eine ehrliche SNB wäre klein, unbedeutend und genau das will niemand. - Weil echte Haftung Gier bremst.
Wenn Banker wüssten, dass sie ihr Haus verlieren, wenn sie zocken, würden sie anders entscheiden. Genau deshalb will das keiner. - Weil die meisten Ökonomen konditioniert sind.
Jahrzehntelang galt: «Kreditexpansion ist Wachstum». Wer das hinterfragt, ist angeblich populistisch oder systemkritisch.
Kurz gesagt:
Unsere Idee würde das Finanzsystem auf echte Beine stellen, aber das hiesse: weniger Profit, weniger Macht, weniger Kontrolle. Niemand will den Brand löschen, solange das Feuer die Heizung ersetzt.
Was wir vom Bundesrat erwarten und was er diesmal fast richtig macht
Die Vorlage des Bundesrats macht die Schweiz nicht sicher(er), sie macht sie beruhigt. Aber immerhin: Sie öffnet die Tür zu einer Diskussion, die längst überfällig ist.
Mehr Eigenkapital im Stammhaus ist nicht falsch, aber es greift zu kurz. Es ist, als würde man das Dach verstärken, während der Keller bröckelt. Denn solange Kundeneinlagen als Risikopuffer missbraucht werden, bleibt das Vertrauen ein Kartenhaus.
Wir verstehen diese Vorlage als Diskussions-Input, nicht als Lösung. Sie zeigt immerhin, dass man den Elefanten im Raum, die systemrelevante Grösse der UBS, nicht mehr völlig ignorieren kann. Aber die eigentliche Aufgabe beginnt erst jetzt: den Mut zu fassen, das System so zu gestalten, dass keiner mehr gerettet werden muss.
Warum echte Stabilität gar nicht gewollt ist
Das globale Finanzsystem ist kein Wirtschaftsmotor, es ist ein perpetuum mobile der Macht. Banken erschaffen Geld aus dem Nichts, Staaten garantieren es mit Steuern, Zentralbanken halten das Karussell am Laufen, und die Politik spielt dabei den Notar, der jede Illusion beglaubigt. Wer an dieser Maschine sitzt, zieht nicht den Stecker, er verkauft den Strom.
Die Finanzoligarchie hält am Casino-Banking fest, weil sie ohne diesen endlosen Geldstrom ihre eigentliche Währung verlöre: Einfluss. Die Hebel heissen Leverage, Derivate und Schattenbilanzen, ihre Wirkung: grenzenlose Liquidität für grenzenlose Kontrolle. Dieses Kapital dient längst nicht mehr der Realwirtschaft, sondern der Machtarchitektur: es kauft Narrative, Medienhäuser, Karrieren und Gesetzestexte. Es finanziert Wahlkämpfe und Farbrevolutionen, orchestriert Stimmungen und schreibt am liebsten selbst die Spielregeln.
Der Bundesrat kann in diesem Gefüge kaum anders handeln. Nicht, weil er böse ist, sondern weil das Spielfeld festgelegt ist. Seine Vorlage simuliert Stabilität, ohne das Spiel zu verändern. Verständlich, aber illusionär.
Wer Reform will, muss an die Wurzel: Geldschöpfung, Haftung, Machtkonzentration. Solange Banken Verluste vergesellschaften und Gewinne privatisieren dürfen, bleibt alles Kosmetik.
Echte Stabilität heisst: Kein Akteur ist zu gross, um zu verlieren und keiner zu klein, um gehört zu werden. Das ist keine Utopie, sondern Souveränität.
Der Bundesrat kann gar nicht anders, aber wir können. Jeder Einzelne von uns.
Und was können wir tun?
Wenn der Bundesrat nicht anders kann, liegt es an uns, die Spielregeln zu ändern. Nicht mit Parolen, sondern mit Haltung.
- Das System sichtbar machen.
Wer versteht, wie Geld entsteht, weiss, warum Stabilität ein Märchen ist. Bildung ist Widerstand, Wissen entwaffnet Macht. - Geld bewusst platzieren.
Nicht jede Bank ist Teil des Problems. Regionalbanken und Genossenschaften tun noch echtes Bankgeschäft. Jeder Franken, der dort landet, entzieht den Grossbanken einen Hebel. - Eigene Strukturen stärken.
Kooperation statt Abhängigkeit. Gemeinschaften, Vereine, Genossenschaften. Das ist echte Resilienz. - Das Narrativ drehen.
Solange Stabilität mit Zentralisierung verwechselt wird, bleibt alles beim Alten. Wir brauchen kein System, das uns beruhigt, sondern eines, das uns gehört.
Das ist, was wir können: Verantwortung zurückholen, Abhängigkeit entlarven, Mut organisieren.
Oder, wie WIR es sagen würden:
Wir können nicht alles ändern, aber wir können bei vielem aufhören, mitzumachen.
Und an alle, die Angst vor einer Schweiz ohne UBS haben
Wenn die UBS wirklich gehen will, bitte sehr, die Tür ist offen. Dubai, New York oder der Mars, sucht euch was Schönes aus.
Wer glaubt, die Schweiz sei ohne eine globale Zockerbank «unbedeutend», hat den Kompass verloren. Ein Land, das Stabilität, Präzision und Vertrauen exportiert, braucht keine Casino-Filiale, um relevant zu sein. Und wer sie trotzdem behalten will, darf sich nicht wundern, wenn er am Ende auch die Verluste behält.
Denn so läuft das Spiel: Wenn’s gut läuft, kassiert die UBS die Boni. Wenn’s schiefgeht, bezahlt ihr die Rechnung: über Steuern, Notrecht oder schleichende Enteignung.
Also entscheidet euch: Wollt ihr eine souveräne Schweiz mit echten Regeln? Oder wollt ihr weiter in der VIP-Lounge der Finanzillusion sitzen, Champagnerglas in der Hand, bis das Casino brennt?
Wenn nicht, dann kümmert euch um diese Vernehmlassung, nicht weil sie die Schweiz rettet, sondern weil sie zeigt, wer sie längst verkauft hat.

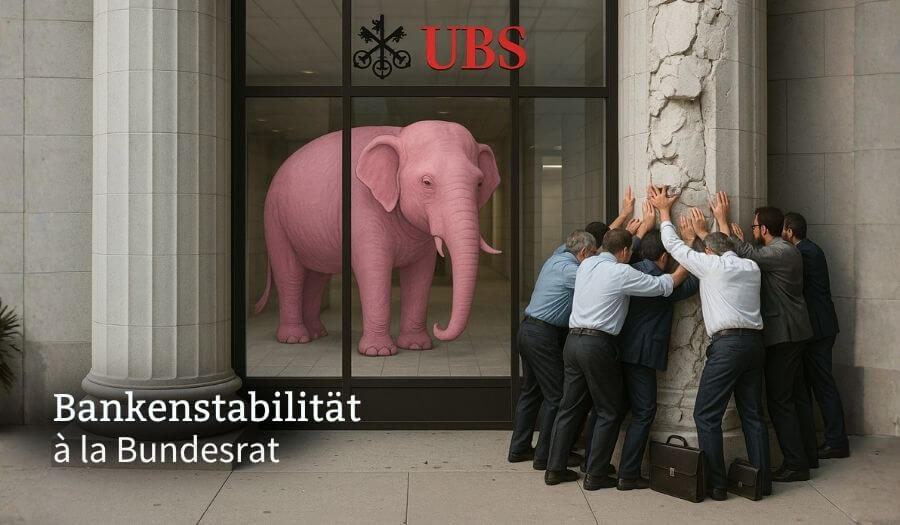
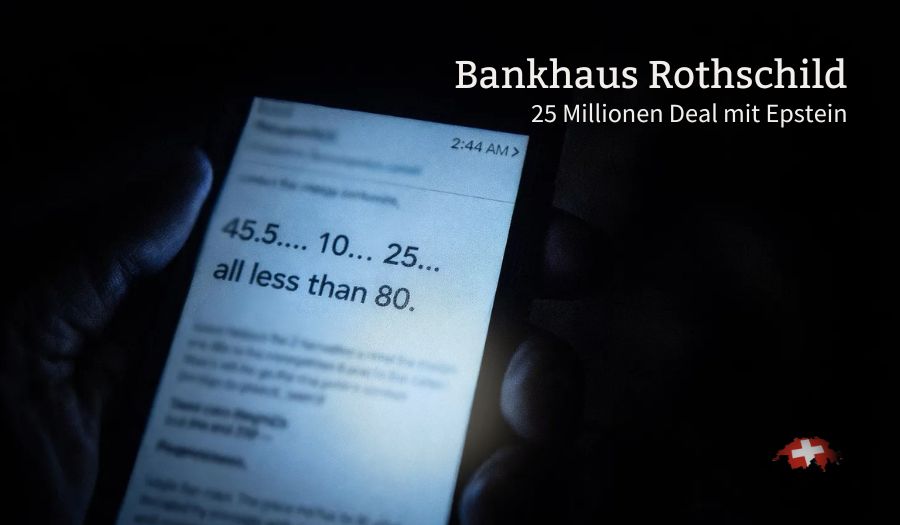







0 Comments