Das Paradoxon der Misinformation
Wenn die Produzenten der Desinformation die Ausstellung über Desinformation eröffnen
Während Bundesrat Rösti in Luzern feierlich den Kampf gegen „Fake News“ beschwört, wird klar: Die grössten Produzenten von Manipulation sitzen längst an den Schaltstellen der Wahrheit. Ein Essay über die neue Zensurindustrie, den schweizerischen Gehorsam und die Freiheit, sich nicht den Mund verbieten zu lassen.
Der neue Tugendkult der Wahrheitsverwalter
Luzern, 13. Oktober 2025. Im ehrwürdigen Verkehrshaus der Schweiz wird feierlich die Ausstellung «Wirklich?! – Fake, Fakt oder Meinung?» eröffnet. Bundesrat Albert Rösti tritt ans Mikrofon, flankiert von SRG-Vertretern und Kommunikationsstrategen des Bundes, um über Medienkompetenz, Desinformation und die Gefahren von Social Media zu dozieren. Es riecht nach Filterkaffee, Selbstgerechtigkeit und der beruhigenden Gewissheit, auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen. Man nickt sich gegenseitig zu, man lobt die „Aufklärung“, man feiert die eigene moralische Hygiene.
Doch wer genauer hinhört, erkennt die Ironie, die kaum noch zu kaschieren ist: Hier predigen jene die Reinheit der Information, die in den letzten Jahren ungeniert manipuliert, verschwiegen und diffamiert haben, ob bei der Pandemie, der Ukraine-Berichterstattung oder den WHO-Verhandlungen. Dieselben Hände, die an der grossen Nebelmaschine der Meinung arbeiten, zeigen nun auf andere und rufen „Fake News!“.
Das ist kein Aufruf zur kritischen Reflexion, sondern eine Generalbeichte unter Kollegen: Man erklärt sich gegenseitig zum Wächter der Wahrheit, während man gleichzeitig bestimmt, was Wahrheit künftig sein darf. Ein PR-Feuerwerk im Namen der Moral, bezahlt von jenen, die noch glauben, dass Demokratie bedeutet, auch widersprechen zu dürfen.
Und doch bleibt eine Frage, die Rösti in Luzern unbeantwortet liess: Wovon reden sie eigentlich, wenn sie „Desinformation“ sagen?
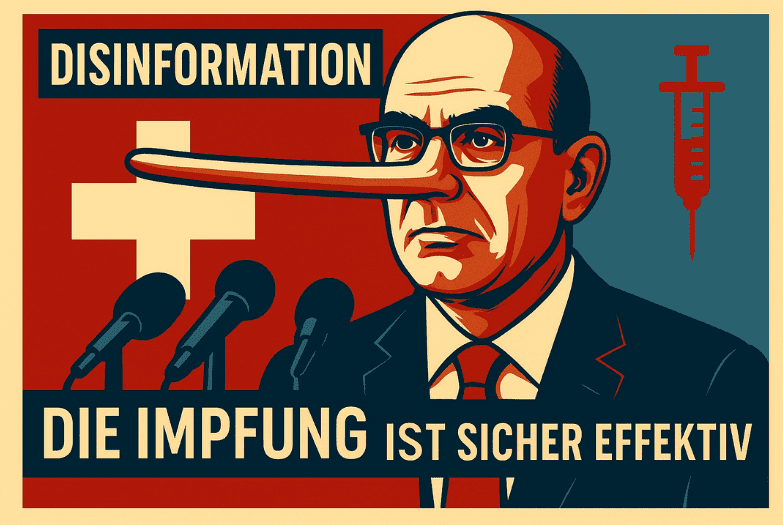
Desinformation oder Misinformation
Der kleine, aber entscheidende Unterschied:
Desinformation bedeutet absichtliche Täuschung. Misinformation hingegen bezeichnet schlichte Irrtümer, abweichende Ansichten oder unvollständige Informationen.
Wer diese Begriffe vermischt, verwischt auch die Grenze zwischen Betrug und Meinung. Und genau das geschieht heute mit System. Bundesrat Rösti sprach in Luzern von „Desinformation“, meinte aber offenkundig beides, die bewusste Lüge ebenso wie den unbequemen Zweifel.
Und genau darin liegt der juristische Sprengsatz: Misinformation ist kein Verbrechen, sondern Teil der freien Meinungsäusserung. Denn die Meinungsfreiheit (Art. 16 BV) schützt ausdrücklich auch Irrtum, Widerspruch und Unbequemes. Wer Irrtum zensiert, verletzt das Recht jedes Bürgers, sich selbst ein Urteil zu bilden.
Selbst Desinformation ist nicht automatisch verfassungswidrig, solange sie keine Straftat erfüllt. Die Bundesverfassung schützt auch das Recht, sich zu irren, zu provozieren oder anderer Meinung zu sein. Das nennt man Freiheit.
So wird aus einem Irrtum ein Vergehen und aus Denken ein Risiko. Es ist die Kunst der modernen Macht: Sie nennt Kontrolle Aufklärung und Zensur Verantwortung.
Wir nennen es das Paradoxon der Misinformation: Die grössten Produzenten von Manipulation inszenieren sich als deren Bekämpfer und verwechseln dabei absichtlich Desinformation mit Meinung.
Vom Militärprojekt zur Meinungswaffe
Das Internet war nie der digitale Garten Eden, als den man es uns später verkauft hat. Es war von Anfang an ein Militärprojekt, geboren aus den Rechenzentren des Kalten Krieges. Man wollte ein Kommunikationssystem schaffen, das auch dann funktioniert, wenn Raketen fliegen und Hauptquartiere in Schutt liegen. Sicherheit, Redundanz, Kontrolle. Das war die DNA.
Dann entdeckte man: Dieses Netz kann mehr als nur Befehle übermitteln. Es kann Befehle in Köpfe pflanzen. Es wurde zur perfekten Bühne für psychologische Kriegsführung: für Narrative, Einflussoperationen, Farbrevolutionen. Wer den Informationsfluss steuert, braucht keine Panzer. Er steuert die Wahrnehmung.
Also liess man das Internet auf die Zivilgesellschaft los, als leuchtendes Symbol der Freiheit, in Wahrheit aber als gigantisches Versuchslabor. Man konnte beobachten, wie sich Stimmungen formen, Bewegungen entstehen, Gesellschaften kippen. Es war das grösste Sozialexperiment der Moderne.
Doch dann geschah etwas, womit die Architekten des Netzes nicht gerechnet hatten: Die Menschen begannen, es gegen sie zu verwenden. Whistleblower, unabhängige Journalisten, Wissenschaftler ausserhalb der Linie, Blogger mit Reichweite. Sie alle fanden im Netz ein Werkzeug, um Wahrheit selbst zu suchen und zu verbreiten.
Die Kontrolle entglitt den Kontrolleuren. Das Monopol auf Deutung war gebrochen. Und was einmal draussen ist, lässt sich nicht mehr zurückholen. Die Paste war draussen aus der Tube.
Die Gegenreaktion: Die Zensurindustrie
Kaum war die Paste draussen, griff das System zum Putzlappen. Was als digitales Freiheitsversprechen begann, wurde binnen weniger Jahre in eine globale Filtermaschine verwandelt. Die alte „Elite“ hatte verstanden: Wenn man die Gedanken nicht mehr lenken kann, muss man wenigstens die Infrastruktur besitzen, auf der sie entstehen.
Hier kommt Mike Benz ins Spiel, ehemaliger US-Diplomat und Insider der digitalen Machtarchitektur. Er nennt das, was sich seit 2014 gebildet hat, den Censorship Industrial Complex, eine fein verästelte Zensur-Industrie, deren vier Säulen sich gegenseitig stützen: Regierung, Medien, Tech-Konzerne und NGOs. Eine Hydra mit akademischem Zertifikat und moralischer Lizenz.
Nach der Krim-Krise erkannte man, dass man keine Panzer braucht, um Länder zu destabilisieren. Es genügt, den Informationsraum zu besetzen. Also begann man, das Internet zurückzuerobern, diesmal unter der Flagge der „Demokratiesicherung“. Eine beispiellose Allianz aus Geheimdiensten, Silicon-Valley-Firmen, Stiftungen und Thinktanks baute ein System, das Benz als „NATO fürs Netz“ beschreibt.
Die Waffen sind subtil, aber effektiv:
- Algorithmische Vorzensur, die Gedanken schon löscht, bevor sie ausgesprochen sind.
- KI-Monitoring, das Sprache nach Emotionen sortiert und auffällige Begriffe auf schwarze Listen setzt.
- Werbeboykotte, mit denen man unbequeme Medien finanziell austrocknet.
- „Trusted Flaggers“, also institutionalisierte Denunzianten, die festlegen, was gelöscht werden muss.
- Regulatorische Hebel, durch die EU-Digitalgesetze Plattformen zu Komplizen staatlicher Zensur machen.
- Und schliesslich internationale Druckmechanismen, die jeden Staat gefügig machen, der sich noch einen freien Diskurs erlaubt.
Offiziell geht es um den Kampf gegen „Hass“ und „Desinformation“. In Wahrheit aber um Meinungskontrolle. Nicht gegen Extremisten, sondern gegen jene, die Fragen stellen. Benz sagt es glasklar: Diese Werkzeuge richten sich nicht gegen Staaten, sondern gegen Populismus, also gegen politische Bewegungen, die das Machtmonopol gefährden.
Nach den Enthüllungen der Twitter Files glaubte man kurz an Selbstreinigung. Doch das System tat, was Systeme immer tun: Es verschob sich einfach eine Etage höher. Heute findet die Zensur nicht mehr auf den Plattformen selbst statt, sondern in der digitalen Infrastruktur – in Cloud-Diensten, App-Stores und Zahlungsplattformen. Tief eingebrannt in die Architektur des Internets selbst. Eine Zensur ohne Zensoren, automatisiert, unsichtbar, endgültig.
Und während die Öffentlichkeit noch glaubt, sie kämpfe um Meinungsfreiheit, verfeinert die Zensur-Industrie längst ihre Software. Das neue Schlagwort lautet „Resilienz“. Es klingt harmlos, nach psychologischer Stärke und gesellschaftlichem Zusammenhalt. In Wahrheit ist es ein Tarnwort für geistige Abrüstung. Resiliente Bürger sollen nicht mehr kritisch prüfen, sondern gelernt gelassen nicken, wenn die nächste Lüge als Wahrheit serviert wird.
Wer nicht ins Raster passt, verschwindet nicht nur aus dem Diskurs, sondern aus der digitalen Existenz. Es ist die sanfte Form der Löschung: nicht der Mensch, sondern seine Reichweite wird ausgelöscht.
So funktioniert moderne Kontrolle, nicht mit Verboten, sondern mit Filtern, Nudging und digitalem Entzug. Der Maulkorb ist heute unsichtbar, aber perfekt angepasst.
Die Schweiz: Musterschüler im globalen Zensurunterricht
Warum macht die Schweiz da so eifrig mit? Weil sie es kann und weil sie es will.
Die vermeintlich neutrale Musterdemokratie spielt brav mit im Spiel der internationalen „Verantwortungsgemeinschaft“. SRG, Bundesräte, Bildungsdepartemente, alle reden von Medienkompetenz, meinen aber Meinungsdisziplin.
Die Schweiz ist klein, aber hochvernetzt. Sie hat keine echte Opposition im klassischen Sinn. Alle grossen Parteien bewegen sich im gleichen Spektrum der „staatstragenden Vernunft“. Kritische Stimmen werden medial isoliert, wirtschaftlich ausgegrenzt oder moralisch diskreditiert. Das politische System ist so konstruiert, dass echte Kurswechsel fast unmöglich sind.
Man nennt es Aufklärung, wenn man Schüler darauf trainiert, offiziellen Quellen mehr zu glauben als ihrem eigenen Urteil. Man nennt es Qualitätsjournalismus, wenn man 1:1 Regierungssprech wiederholt. Und man nennt es Demokratieförderung, wenn man Plattformen zwingt, unliebsame Inhalte zu löschen.
Die Schweiz ist kein Testlabor, sondern ein Störfaktor, der ruhiggestellt werden muss. Ihre formale Neutralität, ihr Referendumsrecht, ihr direktdemokratischer Sonderstatus, all das steht quer zu den transatlantischen Machtstrukturen. Darum: Man integriert sie schleichend über Soft Power, Narrative, Abhängigkeiten, aber ohne es laut zu sagen.
Die Schweiz wird somit zum Kontrollobjekt. Kein Experiment, sondern ein Lehrbuchfall für narrative Disziplinierung. Solange sie nicht offiziell zur NATO und zur EU gehört, darf sie auch keine Debatte darüber führen. Denn wer über Souveränität spricht, gefährdet das Drehbuch der Integration. Das Programm zur „Resilienz der Demokratie“ ist nichts anderes als die sedierte Form des Gehorsams. Ein transatlantisches Schweigegelübde im Namen der Stabilität.
Und Bundesrat Rösti? Er liefert die Schweizer Variante dieses Gehorsams gleich mit: charmant verpackt, brav serviert, pflichtbewusst durchgezogen. Seit seiner Ernennung beweist er, dass man auch als Volksvertreter wunderbar funktionieren kann, ohne das Volk wirklich zu vertreten. Der perfekte Beamte im Anzug der Demokratie: loyal nach oben, lehrmeisterlich nach unten.
Das Paradoxon in Reinform
Wer die Wahrheit kontrollieren will, nennt alles andere Lüge. Wer selbst Lügen verbreitet, braucht einen moralischen Vorwand, um Kritiker mundtot zu machen. Und genau das ist das Erfolgsrezept moderner Macht: Sie kleidet Kontrolle in Tugend.
So entsteht die perfekte Symbiose aus Macht und Moral. Die politischen Überzeugungstäter nennen es „Schutz der Demokratie“, aber sie meinen den Schutz vor der Demokratie. Denn eine echte, mündige Bevölkerung wäre unberechenbar. Sie könnte ja falsche Fragen stellen, falsche Leute wählen, falsche Wahrheiten erkennen.
Deshalb braucht es heute eine ganze Industrie der Deutung. Faktenchecker, Taskforces gegen Desinformation, Kompetenzzentren für digitale Resilienz. Alles schön klingende Tarnbegriffe für dieselbe Mission: Kontrolle über den Diskurs. Sie prüfen keine Fakten, sie schützen Narrative. Sie halten nicht die Wahrheit fest, sondern die Linie.
Wer widerspricht, wird nicht widerlegt, sondern gelöscht. Wer fragt, gilt als verdächtig. Und wer darauf besteht, dass zwei plus zwei vier ergibt, wird „problematisch“ genannt, wenn die offizielle Linie gerade fünf braucht. Das ist keine Übertreibung, sondern Alltag in der neuen Wahrheitsökonomie.
Das Paradoxon der Misinformation ist damit vollständig: Diejenigen, die Misinformation bekämpfen, sind ihre grössten Produzenten. Sie schaffen das Problem, um sich selbst als Lösung zu verkaufen. Ein sich selbst nährender Kreislauf der Manipulation.
Denn solange sie bestimmen dürfen, was wahr ist, können sie jede Lüge zur Tugend erklären. Das ist die neue Definition von „Demokratieschutz“: Du darfst alles sagen, solange du sagst, was sie hören wollen.
Schluss mit Samthandschuhen
Die Misinformanten sitzen nicht in dunklen Kellern mit Troll-Accounts. Sie tragen Anzüge, lesen vom Teleprompter und nennen sich Bundesräte, Journalisten oder Faktenchecker.
Früher konnte jeder erzählen, die Erde sei flach, Elvis lebe auf dem Mond oder Alain Berset sei ein Echsenwesen, und niemand kam auf die Idee, deshalb ein Ministerium für Wahrheit zu gründen. Warum? Weil freie Gesellschaften damit leben konnten, dass Unsinn eben zum Preis der Freiheit gehört.
Heute aber ist Misinformation plötzlich eine „Bedrohung der Demokratie“. Das ist der entscheidende Paradigmenwechsel. Nicht, weil die Theorien gefährlicher geworden wären, sondern weil die Systeme empfindlicher geworden sind. Ein wirklich stabiles, demokratisches System hat keine Angst vor Spinnereien im Internet. Nur ein fragiles, von oben gesteuertes System fürchtet die Unberechenbarkeit seiner eigenen Bürger.
Denn stabile Demokratien reagieren auf Kritik mit Argumenten, nicht mit Löschbefehlen. Doch wenn Macht auf Unsicherheit trifft, wird Zensur zur Therapie. „Misinformation“ ist kein Schutzschild der Demokratie, sie ist ihr Maulkorb.
Darum gilt: Wer Wahrheit fürchtet, fürchtet Freiheit. Und wer die Freiheit liebt, muss lernen, durch die Nebel der Misinformation hindurchzusehen, auch wenn sie aus Bern kommt.
Die Schweizer müssen begreifen: Der Kampf um Informationsfreiheit ist kein amerikanisches Randthema, sondern eine Frage der Souveränität. Wer seine Meinung nur noch in genehmigten Formaten äussern darf, hat längst verloren. Die neue Gefahr heisst nicht Misinformation, sie heisst Konformität.
Wir lassen uns deshalb unsere Wahrheiten nicht verbieten. Punkt. Wer frei denkt, ist schon Widerstand genug.

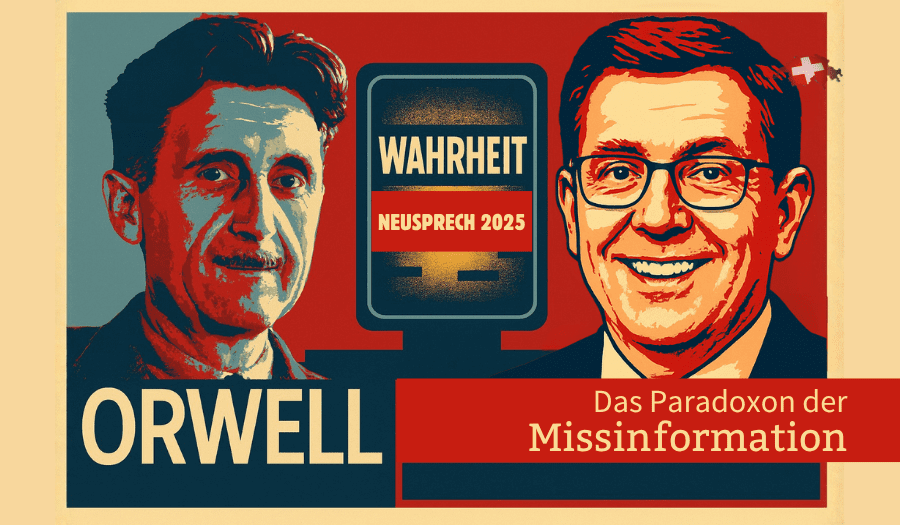








0 Comments