Die neue Sünde heisst Barabhebung
Die Schweiz und ihr Misstrauensfetisch
Willkommen im Finanz-Beichtstuhl
Du willst dein eigenes Geld abheben? Wie süss. In einer Zeit, in der jeder Kontoauszug verdächtiger ist als ein leerer USB-Stick im Bundeshaus. Früher ging man zur Bank, um sein Geld zu holen. Heute geht man hin, um sich zu rechtfertigen.
«Wofür brauchen Sie das Bargeld?» Das ist kein Scherz, das ist die neue Gretchenfrage der Finanzmoral.
Wer antwortet: Weil’s meins ist, fliegt raus aus dem Vertrauenssystem. Wer flüstert: Diskret. Persönlich. Ohne Quittung., der bekommt vielleicht noch ein Lächeln und ein Formular.
Und nein, das ist keine Anekdote aus einem Überwachungsstaat, sondern Alltag in der Schweiz. Fast jeder kennt inzwischen jemanden, der erklären musste, warum er sein eigenes Geld benutzt.
(Randbemerkung: Ich empfehle meinen Freunden immer zu sagen, dass man das Geld für ein Anal-Bleaching oder eine Vaginalstraffung brauche und das nicht auf der Kreditkartenabrechnung stehen haben wolle. Dann ist subito Ruhe im Karton.)
Wenn dein Konto zur Risikoakte wird
Die Banken nennen es «Sorgfaltspflicht». Wir nennen es, was es ist: flächendeckendes Misstrauen mit Geschäftsmodell. Ab einer gewissen Summe mutiert dein Kontoauszug zum Tatverdacht. Die Bank will wissen, warum du dein eigenes Geld anfassen willst und ob du dafür eine plausible Geschichte parat hast.
Kein Grund? Kein Zugriff.
In der Schweiz, dem angeblich sichersten Land der Welt, gilt inzwischen ein ungeschriebenes Gesetz: Alles, was du besitzt, ist verdächtig, bis du das Gegenteil bewiesen hast.
Die Schweiz – sauber bis zur Selbstverleugnung
Offiziell heisst es: Schutz vor Geldwäscherei. Tatsächlich ist es der Schutz der Banken: vor der FINMA, vor Reputationsrisiken, vor der eigenen Angst, etwas falsch zu machen.
Die FINMA schreibt:
«Finanzintermediäre müssen bei ungewöhnlichen Transaktionen die Herkunft der Vermögenswerte prüfen und dokumentieren.»
Das klingt vernünftig, bis man merkt, dass «ungewöhnlich» alles heissen kann: von der Barabhebung für ein Auto bis zum Geburtstagsgeschenk für die Nichte.
Selbst die Swiss Bankers Association gibt zu, dass «der Interpretationsspielraum gross» ist. Übersetzt heisst das: Wir wissen auch nicht genau, wann Vertrauen aufhört und Überwachung anfängt.
Von der Sorgfaltspflicht zur Verdachtsreligion
Die Geldwäschegesetzgebung (GwG) ist wie ein Virus: Sie breitet sich still aus, infiziert Systeme, bis niemand mehr weiss, wo gesunder Menschenverstand aufhört.
MROS, die Meldestelle für Geldwäscherei beim Bundesamt für Polizei, vermeldet jedes Jahr Rekorde:
2023 wurden über 9’000 Verdachtsmeldungen eingereicht.
Neun-tausend! So viele Drogenbosse hat die Schweiz nicht einmal in den Netflix-Serien.
Aber MROS freut sich: «Das Bewusstsein für Risiken ist gestiegen.» Natürlich. Das Bewusstsein steigt immer dann, wenn der Generalverdacht zum Volkssport wird. Es sind keine Gesetze mehr, es ist ein Glaubenssystem und jeder Kunde ist sein eigener Ketzer.
Der Alltag des Misstrauens
Ab einer gewissen Summe, sagen wir 15’000 Franken, wird das Abheben deines eigenen Geldes zum Verwaltungsakt. Du brauchst keine Pistole, um eine Bank nervös zu machen, nur ein Bündel Noten.
Und wehe, du hebst regelmässig kleinere Beträge ab. Dann nennt sich das im Banker-Deutsch «Structuring» oder «Smurfing», das vorsätzliche Zerteilen verdächtiger Beträge. Ein schöner Begriff, fast putzig. Nur, dass du der Schlumpf bist, und Papa Schlumpf heisst Compliance Officer.
Gespräch am Schalter
Kunde: 20’000 Franken in bar, bitte.
Bankangestellte: Darf ich fragen, wofür?
Kunde: Für meine Freiheit. Ich will mal wieder sehen, wie sie aussieht, wenn sie in Scheinen kommt.
Bankangestellte: Haben Sie das schriftlich?
Kunde: Noch nicht. Aber wenn Sie mich weiter fragen, schreibe ich’s gleich in meine Kündigung.
Eigentum mit Ablaufdatum
Im Gesetz steht, Eigentum sei geschützt. Aber das ist Theorie. Wie die Neutralität. Praktisch gehört dein Geld der Bank, bis sie dir erlaubt, es zu benutzen.
Das Konto ist kein Tresor, sondern ein moralischer Prüfstand. Dein Verhalten entscheidet, ob du würdig bist, dein eigenes Geld zu berühren. Und die Bank? Sie ist nicht mehr Dienstleister, sondern eine Art Finanzpolizei mit Wohlfühlmusik im Hintergrund.
Die Psychologie des Verdachts
Verdacht ist wie Schimmel. Er wächst im Dunkeln, braucht keine Beweise, nur Feuchtigkeit und Angst. Das neue Finanzsystem basiert nicht auf Vertrauen, sondern auf präventiver Panik.
«Overcompliance» nennen die Banken das, und es klingt fast charmant, als wäre es eine Tugend, sich freiwillig zu ducken. Dabei ist es nichts anderes als vorauseilender Gehorsam.
Und wer zu oft gehorcht, vergisst irgendwann, dass er mal Rechte hatte.
Die neue Schamökonomie
Barzahlung ist heute, was Rauchen in Restaurants in den 90ern war: legal, aber moralisch verwerflich. Wer bar zahlt, hat etwas zu verbergen. Wer abhebt, steht unter Beobachtung. Und wer nachfragt, bekommt den Verweis auf «gesetzliche Pflichten». Ein Satz so leer wie ein Sparkonto nach der Stromrechnung.
Ein Banker sagte kürzlich in einem Fachinterview (Quelle: NZZ):
«Wir haben keine Wahl. Die FINMA erwartet, dass wir Auffälligkeiten melden, selbst wenn sie nur potenziell relevant sind.» Mit anderen Worten: Misstraue allen und du machst Karriere.
Das Ende des Eigentumsgefühls
Früher war Geld ein Werkzeug. Heute ist es eine Prüfung. Man verdient es, man versteuert es, man bittet um Erlaubnis, es zu benutzen. Und wenn du Pech hast, entscheidet ein Algorithmus, ob deine Transaktion «auffällig» war.
Was du auf deinem Konto siehst, ist kein Vermögen. Es ist eine Gutschrift auf Bewährung. Das Geld gehört dir, bis du es brauchst. Dann gehört es dem System.
Letzter Ausweg: Abheben statt Abbitte
Mach’s wie deine Grosseltern: Bring dein Geld gar nicht erst aufs Konto. Und wenn’s schon dort ist, heb es ab, bevor es jemand anderes für verdächtig erklärt.
Leg es unter das Kopfkissen, in den Garten, in die Matratze oder in die Weinflasche. Egal. Nur nicht ins Bankensystem, das dich behandelt, als wärst du ein Problem mit IBAN.
Denn wer heute bar bezahlt, begeht keinen Fehler. Er begeht Widerstand und zeigt mehr Mut als alle, die noch glauben, ihr Konto gehöre ihnen.


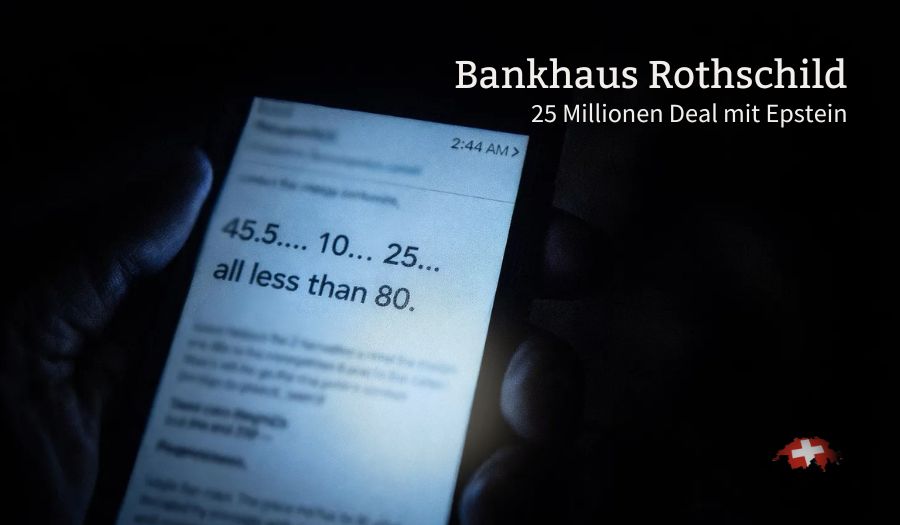







0 Comments