E-ID: Das perfekte Ergebnis
Warum die Schweiz nichts anderes liefern durfte
Stell dir vor, ein Volk sagt vier Jahre lang laut und deutlich „Nein“ und plötzlich heisst es „Ja“. Zu genau derselben Sache, nur mit neuem Anstrich. Klingt wie Zauberei? Willkommen in der Schweiz 2025.
Kurz vorweg: Die E-ID wurde am 28.09.2025 äusserst knapp angenommen (ca. 50,39 % Ja). Wir unterstellen keinen Wahlbetrug. Aber wir zeigen, warum die Schweiz politisch-strukturell kein anderes Ergebnis bringen durfte und weshalb das Resultat so sauber ist, dass es stinkt.
Die drei Leitfragen
1) Warum kippt das Volk in 4 Jahren von NEIN (2021) zu JA (2025)?
2021 sagten 64,4 Prozent der Stimmbürger wuchtig Nein zur E-ID. Damals war klar: Keine privatwirtschaftliche Identität, kein Spielball für Konzerne. Vier Jahre später sagt das gleiche Volk Ja, angeblich aus Einsicht in die „staatliche Lösung“. Doch was hat sich wirklich verändert? Nicht das Ziel, sondern die Verpackung. 2021 hiess es „privat“, 2025 hiess es „staatlich“, „gratis“, „freiwillig“, „datensparsam“. Dieselbe Richtung, nur eine hübschere Schleife.
Dazu kam die volle Ladung Narrativ-Dampfwalze: Begriffe wie „Modernisierung“, „Sicherheit“, „Deepfake-Ära“, „EU-Kompatibilität“ machten die Runde. Wer dagegen war, galt als analoger Troll. Ergänzt wurde das durch die Mischung aus Angst und Bequemlichkeit. Behördenwege, Bankgeschäfte, Altersverifikation, Tickets, alles soll „bequemer“ werden. Der Preis dafür: Identität als Eintrittsticket in die digitale Welt.
Das Parlament und der Bundesrat winkten die Vorlage durch, begleitet von Buzzwords wie Privacy by Design und Self-Sovereign Identity. Das klingt nach Transparenz, ändert aber nichts daran, dass am Ende ein nationales Ident-Ökosystem geschaffen wurde, das nahtlos anschlussfähig nach aussen ist. Mit anderen Worten: Die Zutat, die 2021 fehlte, war nicht Technik, sondern Storytelling.
2) Warum wirkt das Resultat so „glatt“ – knapp, aber perfekt passend?
Ein knapper Sieg verkauft sich besser als ein deutlicher. Ein 50:50-Resultat vermittelt das Gefühl, hart erkämpft und deshalb besonders legitim zu sein. Und genau so war es diesmal: Das Ja war hauchdünn, aber eben doch ein Ja. Ein „Legitimationsgold“, das sich politisch bestens verkaufen lässt.
Hinzu kommt die Struktur der Prozessketten. Zentralisierte Abläufe, wie etwa die Briefzentren (Härkingen lässt grüssen), sind keine Beweise für Manipulation. Aber sie sind strukturelle Single Points of Failure. Vertrauen entsteht nicht durch das Versprechen, dass alles korrekt läuft. Vertrauen entsteht durch echte Transparenz. Und die fehlt. Wenn Regierung, Verwaltung, grosse Parteien, Verbände und Leitmedien synchron trommeln, ist die Ergebnisbandbreite vorgezeichnet. Nicht, weil gezählt wird, wie man will, sondern weil gedacht wird, wie man soll. Man muss gar nichts fälschen, wenn man die Frames setzt und die Infrastruktur baut, die nur eine Richtung kennt.
3) Wer profitiert wirklich?
Offiziell profitieren natürlich die Bürger: Sie erhalten Bequemlichkeit, digitale Effizienz, weniger Papierkram. Doch das ist nur die Oberfläche. Tatsächlich profitiert vor allem der Staat, der ein einheitliches digitales Schienennetz für Identität (eine Art Daten-Autobahn für Ausweise) erhält, das für alles genutzt werden kann: von E-Government bis Strafverfolgung. Auch die grossen Akteure wie Banken, Versicherer und Plattformbetreiber freuen sich, denn KYC-ready Bürger (KYC = know your client) sind reibungslos integrierbar. Die Reibung sinkt, die Kontrolle steigt.
Und noch wichtiger: internationale Programme. Ohne einheitliche, interoperable IDs gibt es keinen EU-eIDAS-Anschluss, keine nahtlosen Grenz-Workflows und kein global kompatibles Credential-Ökosystem. Der Bürger bekommt also eine neue Abhängigkeit: heute noch freiwillig, morgen der faktische Zwang. Denn wer kein E-ID-Wallet hat, bleibt draussen.
Worum es wirklich geht: Agenda 2030 & CBDCs
Die E-ID ist nicht einfach nur ein „digitaler Ausweis“. Sie ist der Grundstein für zwei grosse Projekte: die Agenda 2030 und die Einführung von CBDCs (Central Bank Digital Currencies). Beide Vorhaben sind ohne eine standardisierte digitale Identität nicht umsetzbar.
Agenda 2030 predigt „digitale Inklusion“ als Pflichtfach. Damit die globale Steuerungslogik funktioniert, braucht es eindeutig adressierbare Subjekte, also Menschen, die digital erfasst, standardisiert und überprüfbar sind. Mit der E-ID wird genau diese Ident-Schicht geschaffen.
CBDCs wiederum, programmierbares Zentralbankgeld, können nur funktionieren, wenn jede Transaktion eindeutig einer Person zugeordnet ist. Ohne sichere Identität gibt es keine durchsetzbaren KYC/AML-Regeln (AML = anti-money laundering), keine zielgerichteten Subventionen, keine Sperren oder Limits. Die E-ID liefert die Basis: Ohne ID kein CBDC-Feinschliff.
Kurz gesagt: Die “Walletisierung“ des Lebens beginnt hier. Heute Ausweis und Tickets, morgen Zertifikate, übermorgen Zahlungs- und Subventionsrechte. Das ist nicht Verschwörung, das ist Systemdesign. Und die Schweiz, die stolz Gastgeberin der grossen Orchestrierer wie UN, WHO oder WEF ist, darf als Musterknabe nicht ausscheren. Das Resultat liefert genau das: das Signal der Anschlussfähigkeit.
Was im Gesetz & Drumherum steckt (in Klartext)
Die E-ID bringt eine staatliche Vertrauensinfrastruktur, eine Schiene zum Ausstellen, Widerrufen, Prüfen und Vorweisen elektronischer Nachweise. Zuerst gibt es ein Bundes-Wallet, später dürfen auch private Wallets angeboten werden, sofern sie die strikten Vorgaben erfüllen.
Von „Open Source“ ist die Rede, aber mit Einschränkungen. Der Quellcode kann nicht offengelegt werden, wenn „Sicherheitsgründe“ oder Rechte Dritter dagegen sprechen. Praktisch bedeutet das selektive Transparenz. Anonyme Altersnachweise sind zwar vorgesehen, aber technisch nur ein Modus im selben System. Die Daten liegen zwar beim Nutzergerät, doch die Steuerungs- und Prüf-Logik bleibt zentral definiert: Standards, Zertifikate, Revocation-Register.
Das Ganze ist „technologieneutral“ und auf „internationale Standards“ ausgelegt, was im Klartext nichts anderes heisst, als dass die Schweiz sicherstellt, dass ihre Infrastruktur voll interoperabel nach aussen ist. Behörden sollen die E-ID akzeptieren. Heute ist das Wahlfreiheit, morgen der faktische Zwang, weil irgendwann nur noch der digitale Kanal offen bleibt.
Risiko-Bilanz: Wo die schöne Theorie kippt
Die Risiken sind offensichtlich.
- Erstens gibt es den Funktion-Creep: Heute Ausweis, morgen Zugangsbremse. Software ist update-bar, Regeln sind änderbar.
- Zweitens entsteht eine Sanktions-Schiene: Wer sich querstellt, kann in einem digitalisierten System punktgenau ausgebremst oder behindert werden.
- Drittens gibt es den Ausschluss durch Gerätevoraussetzungen: „Freiwillig“, aber ohne aktuelles Smartphone? Pech gehabt.
- Viertens die selektive Transparenz: Quellcode-Ausnahmen und zentrale Register erzeugen eine Vertrauenslücke by design.
- Fünftens die Single Points of Failure: Zentralisierte Knoten wie Register oder Logik-Server sind Angriffsfläche, sowohl technisch als auch politisch.
„Wir behaupten NICHT …“ (aber wir wären naiv, es zu ignorieren)
Wir behaupten nicht, dass manipuliert wurde. Wir wissen es nicht. Wir behaupten nicht, dass Briefzentren wie Härkingen böse sind. Wir sagen: Zentralisierte Abläufe brauchen ausserordentliche Transparenz. Wir behaupten nicht, dass die E-ID zwangsläufig zum Social Scoring führt. Wir sagen: Die Voraussetzungen dafür werden nun geschaffen.
Die Konsequenz ist simpel: Wer das Resultat „einfach akzeptiert“, akzeptiert das Betriebssystem, das dieses Resultat erwartbar macht.
Was jetzt zu tun ist
(praktisch, sofort, unbequem)
Für Bürger & Gemeinden: Akteneinsicht und Protokolle einfordern, Transparenzberichte verlangen, zivilgesellschaftliche Abstimmungs-Beobachter schulen, analoge Alternativen einfordern und Mehr-Wallet-Fähigkeit sichern.
Für Medien & Parlamente: Quellcode-Klausel nachschärfen, Register-Governance offenlegen, gesetzliche rote Linien definieren (keine Verknüpfung mit Zahlungs- oder Gesundheitsrechten ohne Referendum), klare Trennung von E-ID und CBDCs gesetzlich fixieren.
Für die Tech-Community: Konkurrenz-Clients entwickeln, Red-Team-Tests durchführen, Schwachstellen veröffentlichen, Usability ohne Zwang fördern und Prototypen mit analogen Fallbacks bauen.
„Schlafschaf“-Glossar
(damit keiner sagen kann, er habe es nicht verstanden)
Die E-ID ist ein digitaler Ausweis als Datensatz mit Attributen wie Name oder Geburtsdatum. Eine Wallet ist eine App, die Nachweise speichert und selektiv preisgibt. Die Vertrauensinfrastruktur ist eine staatlich betriebene Schiene zum Ausstellen und Prüfen von Nachweisen. Verifikatoren sind Stellen, die deine Angaben prüfen und Zugänge freischalten oder sperren. Self-Sovereign Identity klingt nach Selbstbestimmung, bedeutet aber nur Selbstbestimmung innerhalb systemischer Leitplanken. KYC/AML („Kenne-deinen-Kunden/Geldwäschereibekämpfung“) ist die Standardformel, mit der jede Ident-Pflicht gerechtfertigt wird. CBDCs sind programmierbares Zentralbankgeld mit eingebauten Regeln wie Limits, Zwecken oder Fristen. Funktion-Creep beschreibt, wenn Systeme still und leise mehr können, als du dachtest.
Fragen, die jeder Journalist jetzt stellen sollte
- Welche konkreten Fälle der Nicht-Offenlegung des Quellcodes sind vorgesehen, und wer prüft diese Ausnahmen?
- Welche Register liegen zentral, und mit welchen Schnittstellen ins Ausland?
- Wie wird Freiwilligkeit garantiert, wenn Behörden die E-ID als Standardkanal definieren?
- Wie wird sichtbar gemacht, wenn Behörden oder Firmen mehr Daten abfragen, als sie eigentlich brauchen?
- Und welche Pilot-Projekte verknüpfen E-ID mit Zahlungs-, Subventions- oder Gesundheitsrechten?
Fazit: Der Musterknabe liefert ab
Die Schweiz hat, wie bestellt, das Signal der Anschlussfähigkeit gesendet. Auf den ersten Blick wirkt das Ergebnis unspektakulär: ein knappes Ja, das man in den Abendnachrichten als nüchternen Fakt abhaken könnte. Doch wer genauer hinsieht, erkennt, dass es sich nicht einfach um eine technische Reform handelt, sondern um einen tiefen Eingriff in das Fundament unserer Gesellschaft. Identität wird nicht mehr als individuelles Recht verstanden, sondern als vorbedingte Infrastruktur für den Zugang zu allen Bereichen des Lebens: von Behördenleistungen über Finanztransaktionen bis hin zu Mobilität, Bildung und Gesundheit.
Das ist der eigentliche Skandal: kein offensichtlicher Betrug, keine sichtbare Manipulation, sondern ein Architektur-Skandal im Unterbau. Die Strukturen, die hier geschaffen wurden, sind so mächtig, dass sie jeden Einzelnen zum Funktionieren innerhalb dieser Schienen zwingen. Wer das als harmlos abtut, hat nicht verstanden, wie Macht im Digitalen wirkt: nicht laut, nicht spektakulär, sondern still, permanent und unumkehrbar. Diese neue Infrastruktur ist wie ein unsichtbares Betriebssystem, das sich über alle Lebensbereiche legt. Man merkt es erst, wenn man ohne dieses System nichts mehr tun kann.
Wir klagen niemanden an, wir zeigen nur, was offensichtlich ist. In der Vasallen-Logik der internationalen Ordnung durfte die Schweiz gar nicht „Nein“ sagen. Als Musterknabe der Global Governance musste sie liefern, was von ihr erwartet wurde. Wer glaubt, es handle sich um eine souveräne Entscheidung des Volkes, unterschätzt die Wucht des internationalen Erwartungsdrucks.
Das „Ja“ zur E-ID ist deshalb nicht nur ein Volksentscheid, sondern ein politisches Signal an UNO, EU und WEF: Die Schweiz bleibt auf Linie.
Genau deshalb sollten wir ab heute jede Zeile Code, jeden Prozessknoten und jede Erweiterung dieses Systems unter die Lupe nehmen. Nicht schulterzuckend, nicht als Bittsteller, sondern als Souverän, der weiss, dass er sonst Schritt für Schritt zum Objekt einer globalen Steuerungslogik degradiert wird. Es geht um nichts weniger als die Frage, ob wir in Zukunft noch Bürger sind, die mitbestimmen, oder ob wir bloss noch Nutzer eines Betriebssystems werden, das uns als Komfortzone verkauft wird, in Wahrheit aber ein digitaler Käfig ist, dessen Gitterstäbe erst dann sichtbar werden, wenn es zu spät ist.
Checkliste für Gemeindebrief an den Gemeinderat
- Analoge Wege sichern: Fordert eine klare Zusage, dass analoge Wege ohne Zusatzkosten und Schikanen erhalten bleiben. Wer lieber mit Papier arbeitet oder persönlich am Schalter steht, darf nicht schlechter gestellt werden, weder finanziell noch organisatorisch.
- Jährliche Berichte verlangen: Besteht darauf, dass jedes Jahr ein Bericht veröffentlicht wird, in dem schwarz auf weiss steht, wer genau eure E-ID abgefragt hat, mit Datum, Grund und verantwortlicher Stelle. Nur so kann sichtbar werden, ob Behörden oder Firmen übergriffig nach zu vielen Daten greifen.
- Keine Zwangs-E-ID: Lasst euch garantieren, dass kein einziger Dienst ausschliesslich per E-ID zugänglich ist. Heute mag noch von „freiwillig“ die Rede sein, doch Freiwilligkeit kippt sofort, wenn plötzlich ein wichtiger Antrag oder ein alltäglicher Service nur noch digital möglich ist. Genau hier braucht es harte Sicherungen.
- Öffentliche Prüfungen durchsetzen: Verlangt eine Verpflichtung zu öffentlichen Prüfungen, vom Quellcode über die Prozesse bis hin zu den Registern, unter Beteiligung von Bürger-Beobachtern, die nicht vom Staat oder Konzernen ausgewählt werden, sondern unabhängig agieren. Nur echte externe Augen können sicherstellen, dass Versprechen nicht zu toten Buchstaben werden.
Merkt euch: “Freiwillig“ ist nur so lange freiwillig, wie ihr ohne es alles genauso gut bekommt. Merkt euch das. Denn sobald ihr für denselben Service plötzlich auf die E-ID angewiesen seid, ist es kein echtes Angebot mehr, sondern ein versteckter Zwang, der nur freundlich verpackt daherkommt. Genau darin liegt die Gefahr: Man merkt den Käfig nicht, solange die Gitterstäbe bunt bemalt sind. Doch wenn du erst einmal drin bist, ist der Ausweg schwer. Also prüfe genau jetzt, bevor sich die Tür hinter dir schliesst.

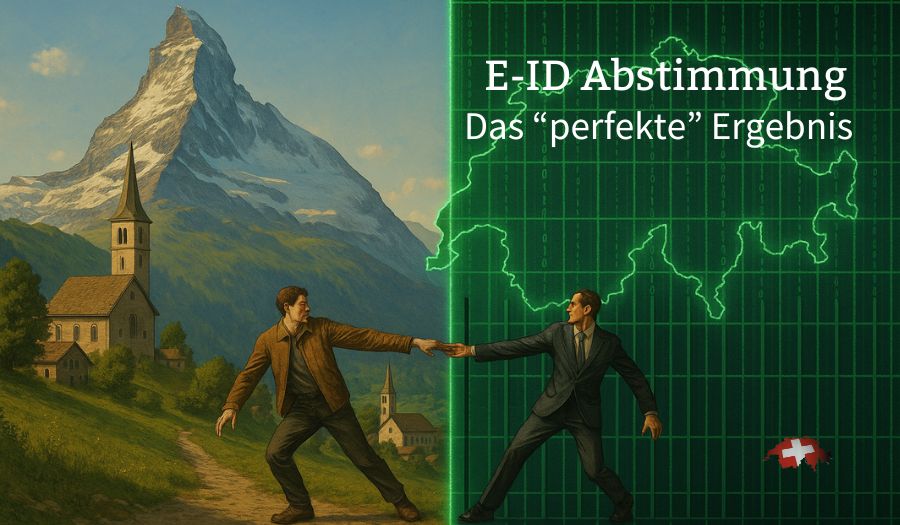








Vasallenstaat – rechtliche Einordnung und Detailanalyse
Definition und Begriffsabgrenzung
Der Begriff Vasallenstaat bezeichnet im völkerrechtlichen Kontext einen Staat, der seine formell anerkannte Souveränität weitgehend verloren hat und sich unter die politische, wirtschaftliche oder militärische Kontrolle eines anderen, übergeordneten Staates (der sogenannten Schutzmacht oder dem Suzerän) stellt.
Ein Staat mit unterschiedlichem Grad an Abhängigkeit in seinen inneren Angelegenheiten, der jedoch in seinen äußeren Angelegenheiten von einem anderen Staat dominiert wird und diesem möglicherweise vollständig unterworfen ist.
Die Stellung eines Vasallenstaats ist durch eine ungleiche Machtverteilung gekennzeichnet, wobei der Suzerän maßgebliche Entscheidungen über die Außenpolitik sowie oft über innere Angelegenheiten trifft.
Die Merkmale sind insbesondere eine formalisierte Unterordnung, die sich in Verträgen, Abkommen oder einseitigen Erklärungen niederschlägt.
Es gibt zwei Arten von Vasallentum: freiwilliges Vasallentum und Kapitulation.
Das Ständemehr war ja eindeutig gegen die e-id. Warum zählt das nicht? Vorallem bei einem so knappen Resultat? Ja und ich bin ganz sicher es gibt einen Plan und der heißt bilaterale-3 der unterwerfungsvertrag an die EU. Nato Beitritt und Abschaffung der Grenzen. Das ist der Fahrplan der Politik und Eliten für sie Schweiz vorgesehen haben. Bezahlen wird dass das Volk. Mit Armut Bevormundung und Verlust aller Rechte. Wir sollen wie Vieh bewirtschaftet werden. Gewinnen wird die Elite. Und ja es ist ein spiritueller Krieg.
Verstößt die E-ID, insbesondere wenn die „Freiwilligkeit“ nicht mehr gegeben ist, nicht gegen die Menschenwürde? M. E. degradiert sie letztlich jeden zur Nummer.
… und ja, wenn erst einmal E-ID, CBDC – in voller Ausbaustufe (Ablaufdatum, Obergrenze, Geofencing usw.-, Social Score umgesetzt sind, kann und wird (!) die „unpassende“ Nummer von einer KI mittels Algorhythmus aussortiert und abgeschaltet. D.h. das gänzlich inhumane Todesurteil ohne Anklage, Anhörung und Verteidigungsmöglichkeit still, leise per Computer ausgeführt wird.
Damit ist auch die „Demokratie“ Geschichte Denn wenn schon eine abweichende Meinung zur totalen Ausgrenzung führt, wer kann dann noch eine Opposition wählen, bzw. wie könnte sich eine solche überhaupt bilden oder gar durchsetzen?
Kauft nicht bei E-ID-Unterstützern! Verweigert die E-ID konsequent! Wer da mitmacht, zementiert seine eigene Versklavung.
Ich bin gespannt, ob hier etwas rauskommt.
https://www.watson.ch/digital/schweiz/893437672-stimmrechts-beschwerde-gegen-e-id-laut-rechtsprofessor-nicht-chancenlos
Ich finde es einfach unglaublich, dass ca. 20.000 mehr Stimmen das Glück einer ganzen Bevölkerung so dramatisch (und evtl. für immer) verändern können. Wir reden hier nicht von einem Gesetz, dass irgendwann vielleicht abgeschafft wird. Mit der Einführung der E-ID ist die Macht jetzt endgültig dem Staat übergeben. Sie sagen es sei freiwillig, aber wer kann mir garantieren, dass es so bleiben wird? Gibt es ein Gesetz zu dieser Aussage oder sind es nur leere Versprechungen? Ich befürchte sehr bald werden wir das gleiche Spiel wie bei den Covid Zertifikaten und Impfungen erleben, die waren zwar nicht obligatorisch, aber wenn man diese nicht hattet, war man von der Gesellschaft und System einfach isolliert.
20.000 Stimmen schweizweit zählen mehr als das Ständemehr!?
Toll, ich könnte einen Screenshot liefern, der zeigt, dass sich im E-Voting das durchschnittliche Abstimmverhalten in diesem Punkt in einer bestimmten Gemeinde von 47% Ja in Konventionell auf 87% Ja geändert hat.
Zwar waren es nur wenige Stimmen, aber da das in mindestens mehreren Gemeinden, wenigstens noch am Sonntag (…), einzusehen war, kommt da schon was zusammen.
Ein Schelm, der …
Nicht wahr?
Welche Kriminellen Vereinigungen haben ihren Sitz in der Schweiz WEF, Gates und sicher auch Soros uvam alle fordern die E-ID . Ich glaube nicht , daß es ehrlich zugegangen, es richt eher nach Prinzip Moldawien. Werden die nächsten Wahlen in der EU genauso ablaufen? Nur was passiert wenn Tagelang der Strom ausfällt oder beiden den Servern „hakt“ also zu längeren Störungen kommt. Dann dürfte nichts mehr gehen. Kein Einkaufen von Lebensmitteln, evtl kommt man nichtmal mehr aus dem Haus ohne durchs Fenster zustellen oder die Türen aufzubrechen. Die Einheimischen werden natürlich brav zu Hause bleiben und trocken Brot kauen. Doch sicherlich nicht die Neubürger, dann wird sich geholt und genommen. In Zukunft kann jeder kleine Hofladen dicht machen und Kasse des Vertrauens ebenso. Bißchen Schrott abgeben oder auf den Flohmarkt etwas verkaufen, daß Finanzamt bekommt alles mit. Sogar den Puffbesuch und wie ist das mit Straßenstrich.
E-Voting wäre der nächste Schritt, so kann man das Ganze einfacher unter Kontrolle haben. Es tut mir sehr Leid, aber letzten Sonntag wurde in der Schweiz die Büchse der Pandora geöffnet.