Gefangen im Globalvertrag
Eine Unterrichtslektion in „Spieltheorie“
Wie die Schweiz im Spiel der Mächtigen ihre Freiheit verliert
Stellen Sie sich vor, zwei Einbrecher sitzen in getrennten Zellen. Die Polizei kann ihnen nichts nachweisen – ausser einem kleinen Waffendelikt. Drei Jahre Gefängnis. Geringfügig. Doch dann kommt das Spiel: Jeder bekommt ein Angebot:
- Wenn einer gesteht, kommt er frei – der andere wandert für zehn Jahre ein.
- Wenn beide gestehen, bekommen sie acht Jahre.
- Wenn keiner gesteht, bleiben es drei.
Klingt nach einem moralischen Drama – ist aber ein mathematisch messbares Phänomen: das Gefangenendilemma. Und das Tragische daran? Allein betrachtet handeln beide rational – gemeinsam handeln sie töricht.
Warum das wichtig ist? Weil genau dieses Dilemma gerade im Herzen der Schweizer Demokratie tobt. Und niemand spricht es offen aus.
Die Schweiz steht an einem geopolitischen Scheideweg: Ob bei den WHO-Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV), dem Pandemievertrag oder den EU-Verträgen. In all diesen Fragen gilt:
- Kooperation mit dem Volk wäre langfristig vernünftig.
- Verrat durch Unterzeichnung ohne Volksabstimmung erscheint kurzfristig rational.
Doch das Resultat ist stets dasselbe: Der Verlust kollektiver Freiheit zugunsten internationaler Kontrollstrukturen und niemand will’s gewesen sein.
Das Gefangenendilemma: Eine verständliche Einführung
Das Gefangenendilemma ist das berühmteste Spiel der Spieltheorie. Es zeigt, wie zwei rationale Akteure, die nur auf ihren eigenen Vorteil achten, gemeinsam in eine schlechtere Lage geraten, obwohl eine bessere Lösung auf der Hand läge.
Das klassische Szenario
Zwei Ganoven sitzen getrennt im Verhör. Die Polizei hat sie bei einem Verbrechen erwischt, kann ihnen aber nichts Handfestes nachweisen, ausser illegalem Waffenbesitz. Wenn beide schweigen, kriegen sie jeweils 3 Jahre – wegen der Waffen.
Aber jetzt wird’s heikel: Wenn einer gesteht und der andere schweigt, kommt der Geständige straffrei raus (0 Jahre), der andere kriegt die volle Packung: 10 Jahre.
Wenn beide gestehen, bekommen sie jeweils 8 Jahre, weil sie wenigstens kooperiert haben und das Gericht das als „Reue“ wertet.
Und genau hier liegt das Dilemma: Jeder denkt sich: Wenn der andere schweigt und ich gestehe, komme ich ganz frei raus – Jackpot! Aber auch: Wenn der andere mich verpfeift und ich schweige, bin ich der Idiot und sitze 10 Jahre ein.
Deshalb sagen beide lieber sicherheitshalber aus und landen beide bei 8 Jahren. Obwohl: Wenn sie beide geschwiegen hätten, wären es nur 3 Jahre gewesen.
Kurz: Das individuell Klügste (Verrat) führt in der Summe zum gemeinsam Schlechtesten. Das ist das Gefangenendilemma in Reinform.
Perfide, oder? Und genau deshalb ist es so mächtig, wenn man es auf echte Politik überträgt.
Das Gefangenendilemma und die neuen EU-Verträge:
Die Schweiz spielt mit dem Feuer
Wenn man wissen will, wie Staaten ihre Souveränität verlieren, muss man nicht auf historische Kriege oder feindliche Übernahmen zurückblicken. Es reicht, einen Blick auf die neuen EU-Verträge zu werfen. Der Bundesrat nennt es „Stabilisierung und Weiterentwicklung der Beziehungen Schweiz–EU“. In Wahrheit ist es ein schleichender Beitritt mit System. Und das perfide: Auch hier greift das Gefangenendilemma. Diesmal im Kleid europäischer Technokratie.
Wiederholung für Schnellleser: Das Gefangenendilemma in einem Satz
Zwei Akteure wären gemeinsam besser dran, kooperieren aber nicht, weil jeder für sich den kurzfristigen Vorteil wählt und am Ende beide verlieren.
Die Schweiz und die EU – ein asymmetrisches Spiel
Was wie ein Handelsvertrag aussieht, ist in Wirklichkeit ein Machtspiel. Die Schweiz wird mit Zuckerbrot („Marktzugang“) und Peitsche („Diskriminierung“) in die Rolle des ewigen Unterzeichners gedrängt. Sie darf zwar beim sog. „Decision Shaping“ mitreden, aber ohne Vetorecht. Wie im klassischen Gefangenendilemma geht es um Vertrauen, um Risikoabwägung und um die Frage: Kooperiere ich, obwohl der andere mächtiger ist und die Regeln diktiert?
Die EU setzt auf ein bekanntes Prinzip: Dynamische Rechtsübernahme. Das bedeutet:
Was in Brüssel beschlossen wird, gilt automatisch (oder unter Druck) auch in der Schweiz. Wer nicht übernimmt, wird sanktioniert. Wer übernimmt, verliert Selbstbestimmung. Wer sich wehrt, riskiert den Ausschluss vom Binnenmarkt. Das ist kein Deal, das ist eine Falle.
Der Bundesrat – der kooperative Spieler, der uns alle mit hineinzieht
Im Gefangenendilemma liegt die Tragik darin, dass Kooperation aus individueller Sicht rational erscheint, aber kollektiv verheerend wirkt. Genau das passiert hier:
- Der Bundesrat will kooperieren – mit dem Ziel, Marktzugang und politischen Goodwill zu erhalten.
- Die EU erwartet Gefolgschaft, nicht Partnerschaft und droht mit Diskriminierung, falls die Schweiz ausschert.
- Das Schweizer Volk ist der Dritte im Spiel und wird durch komplexe Verfahren, technische Begriffe und ein Referendums-Minimum (50.000 Unterschriften!) systematisch entmachtet.
Was wie ein Fortschritt verkauft wird, ist in Wahrheit ein Rückschritt in Sachen Demokratie. Die Dynamik-Klauseln, die Unterordnung unter EU-Agenturen, das Gesundheitsabkommen im Schatten der WHO-Verträge, all das entzieht sich dem direkten Einfluss der Bevölkerung.
Wenn alle „D“ denken, verliert das Gemeinwohl und die Schweiz bleibt brav bei „C“
In der Spieltheorie steht „D“ für Defection (zu Deutsch Verrat), also den bewussten Bruch mit Kooperation: Ich mache nicht mit, ich verfolge mein eigenes Interesse. „C“ hingegen steht für Cooperate (zu Deutsch sich fügen), für das gemeinsame Spiel, für Anpassung, für Einordnung in die Spielregeln anderer.
Jetzt übertragen wir das auf die Politik, insbesondere auf die Schweiz und die EU:
Die EU denkt strategisch. Sie verfolgt Interessen. Sie will Macht sichern, Regeln setzen und durchsetzen. Kurz: Sie spielt „D“ und das ist in der Spieltheorie oft die dominante Strategie. Warum? Weil man kurzfristig gewinnt, wenn der andere sich brav an die Regeln hält. Die Schweiz dagegen spielt „C“. Sie kooperiert. Passt sich an. Schluckt Regeln, die andere machen. Nicht aus Überzeugung, sondern weil sie glaubt, sich damit Ärger zu ersparen. Aber das ist ein Trugschluss. Denn wenn der dominante Spieler „D“ wählt – also eigene Regeln durchdrückt – dann verliert der kooperative Spieler „C“ auf lange Sicht Souveränität, Einfluss und Entscheidungsfreiheit.
Und jetzt kommt’s ganz dicke: Wenn ein Spiel dauerhaft zwischen „C“ und „D“ gespielt wird, gewinnt immer der, der „D“ spielt, solange der andere sich nicht wehrt. Die EU weiss das. Die Schweiz ignoriert es. Und so passiert genau das, was das Gefangenendilemma lehrt: Einseitige Kooperation wird bestraft.
Denn das eigentliche Dilemma ist:
- Wer brav mitspielt, verliert am Ende seine Unabhängigkeit.
- Wer sich verweigert, riskiert kurzfristige Konflikte, aber kann langfristig frei bleiben.
Was heisst das konkret? Die Schweiz „kooperiert“ sich Schritt für Schritt in ein Korsett. Ob bei Schengen, Strom, Personenfreizügigkeit oder eben bald bei einem neuen institutionellen Vertrag. Sie glaubt, durch Anpassung den Frieden zu bewahren. Aber sie opfert damit ihre eigene demokratische DNA: das Recht, selbst zu entscheiden und nicht auf Zuruf von Brüssel.
Kurz: Die Schweiz spielt „C“ in einem Spiel, das längst von den „D“-Spielern dominiert wird. Und wer in so einem Spiel zu nett ist, zahlt am Ende den vollen Preis. In Souveränität. In Selbstbestimmung. In Demokratie.
Was also tun?
Das Gefangenendilemma kennt Auswege. Aber nur dann, wenn man das Spiel durchschaut:
- Wiederholung durch direkte Demokratie: In einem wiederholten Spiel können Kooperationen entstehen, wenn Akteure sich gegenseitig beobachten und sanktionieren können. In der Schweiz heisst das: Referenden. Jedes Mal. Ohne Ausnahme.
- Transparenz: Der Bundesrat muss gezwungen werden, jeden Vertrag, jede Klausel, jede Dynamik offenzulegen ohne Brüssel-kompatibles Schönsprech.
- Zivilgesellschaftliche Wachsamkeit: Es braucht Organisationen wie den Schweizerischen Verein WIR, die den Nebel der Begriffe lichten und das Spiel offenlegen.
- Ein Nein mit System: Wer sich auf ein solches Vertragsgeflecht einlässt, muss vorher das Gefangenendilemma verstanden haben und sich bewusst entscheiden, aus dem Spiel auszubrechen.
Denn das Gefährlichste ist nicht das Spiel selbst, sondern wenn die Spieler nicht merken, dass sie Teil eines Spiels sind.
FAZIT:
Wer das Spiel nicht versteht, wird zur Spielfigur
Ob WHO oder EU, der Spielplan ist derselbe: Internationale Akteure setzen Regeln, die Schweiz nickt ab. Das eine nennt sich Gesundheitskrisenmanagement, das andere Marktzugang. Doch in Wahrheit geht es in beiden Fällen um eines: den schleichenden Verlust demokratischer Kontrolle zugunsten zentralisierter Machtstrukturen.
Der Bundesrat spielt brav mit, kooperiert, vertraut, unterschreibt. Dabei ignoriert er, dass er sich gleich zweimal ins gleiche Gefangenendilemma manövriert hat: Erst mit Genf, dann mit Brüssel. In beiden Fällen geht es um Macht, und in beiden Fällen sitzt die Schweiz am falschen Ende des Verhandlungstischs.
Wer Schach spielt, sollte nicht mit geschlossenen Augen ziehen. Wer Russisches Roulette spielt, sollte zumindest wissen, wie viele Patronen in der Trommel sind.
Die Schweiz aber spielt beides – und tut so, als sei es Jassen.
Höchste Zeit, das Spiel zu beenden. Oder wenigstens die Spielregeln offenzulegen.
Und wenn wir schon bei Gefangenen sind: Vielleicht braucht es genau jetzt den Chor der hebräischen Gefangenen aus Verdis Nabucco, der nicht nur für musikalische Grösse, sondern auch für ein tiefes Freiheitsverlangen steht.
„Va, pensiero, sull’ali dorate“ – Flieg, Gedanke, auf goldenen Schwingen.
Ein Chor der Hoffnung – damals im Babylonischen Exil, heute im föderalen Schlaf der Schweiz. Der Gedanke an Freiheit fliegt weiter. Nur: Wollen wir ihn singen oder weiter zuschauen, wie andere das Lied schreiben?
Bonusabschnitt
SPIELTHEORIE FÜR AUFWACHER
Oder: Wie man sich nicht freiwillig mattsetzen lässt
Was ist ein „Spiel“? In der Spieltheorie ist ein Spiel jede Entscheidungssituation mit mehreren Beteiligten, bei der das eigene Ergebnis auch davon abhängt, was die anderen tun. Das gilt für Poker, für Spülmaschinenpläne in der WG und eben auch für WHO-Verträge und EU-Verhandlungen. Kurz: Wenn du deinen eigenen Ausgang nicht mehr allein bestimmen kannst, bist du in einem Spiel. Und wer das Spiel nicht erkennt, wird zur Spielfigur.
Spieler, Strategien, Spielzüge
Ein Spiel besteht immer aus:
- Spielern (Akteure mit Einfluss – Schweiz, EU, WHO, Konzerne, Bürger)
- Strategien (Was tue ich? Kooperieren oder ausscheren?)
- Auszahlungen (Was gewinne oder verliere ich?)
- Regeln (Wer darf was? Wer setzt durch?)
Beispiel Schweiz:
- Die WHO legt Regeln vor, die Schweiz darf zustimmen oder nicht.
- Die EU verhandelt neue Verträge, die Schweiz darf kooperieren oder blockieren.
- Der Bürger? Darf zusehen oder das Spiel sprengen.
Dominante Strategie – der Denkfehler der Braven
Eine dominante Strategie ist eine, die immer besser abschneidet, egal, was der andere macht. Blöd nur: Wenn alle dominant denken, verlieren alle. Denn: In internationalen Beziehungen gibt’s oft keine wiederholte Gerechtigkeit, sondern Machtspiele. Wer immer „kooperiert“ (C), wird von den „Defectors“ (D) plattgemacht. Die EU denkt strategisch. Die WHO denkt geopolitisch. Die Schweiz denkt… nett. Und nett ist bekanntlich die kleine Schwester von… na, du weisst schon.
Falsche Annahmen, echtes Risiko
Nicht alle Spiele sind fair. Nicht jeder Gegner ist ehrlich. Nicht jedes Spiel sollte man mitspielen. Wer glaubt, internationale Verträge seien von Natur aus „kooperative Spiele“, verwechselt UNO-Rhetorik mit Realität. Kooperationsspiele setzen Vertrauen voraus. Was wir hier haben, ist Machtasymmetrie.
Spielverderber erwünscht!
Wenn Du das Spiel nur verlierst, steig aus. Oder verändere die Regeln. Oder baue ein neues Spiel mit eigenen Regeln.
Und genau deshalb:
- braucht es Referenden.
- braucht es Transparenz.
- braucht es mutige Akteure, die sagen: Wir spielen nicht mehr mit.
Fazit? Die WHO spielt Pandemie-Schach. Die EU spielt Vertrags-Tetris. Der Bundesrat spielt Jassen mit Falschblatt. WIR spielen Spieltheorie und durchschauen den ganzen Zauber.
Wer mehr über die Spieltheorie wissen möchte:
Standardwerk (auf Deutsch):
Christian Rieck – „Spieltheorie: Einführung in das strategische Denken“
- Verlag: Springer
- Sehr verständlich geschrieben, mit vielen Beispielen (auch aus Alltag und Politik)
- Deckt sowohl klassische als auch fortgeschrittene Themen ab (wie wiederholte Spiele, Evolutionäre Spieltheorie etc.)
Empfehlung des Autors: Prof. Rieck hat einen ausgezeichneten YouTube-Kanal, in dem er Spieltheorie sehr anschaulich erklärt und viele aktuelle Themen spieltheoretisch erläutert.
Weitere empfehlenswerte Bücher (wenn’s mehr sein darf):
- Martin J. Osborne – Einführung in die Spieltheorie
- Eher mathematisch und formal, aber ebenfalls ein Klassiker (Original auf Englisch: An Introduction to Game Theory)
- Ken Binmore – Spieltheorie: Eine Einführung
- Übersetzt aus dem Englischen (Game Theory: A Very Short Introduction)
- Kurz, prägnant, zugänglich – eher als Einstieg geeignet
- Gerd Gigerenzer ist mehr bekannt für Entscheidungspsychologie und „Heuristics“ – auch spannend, aber nicht direkt Spieltheorie.


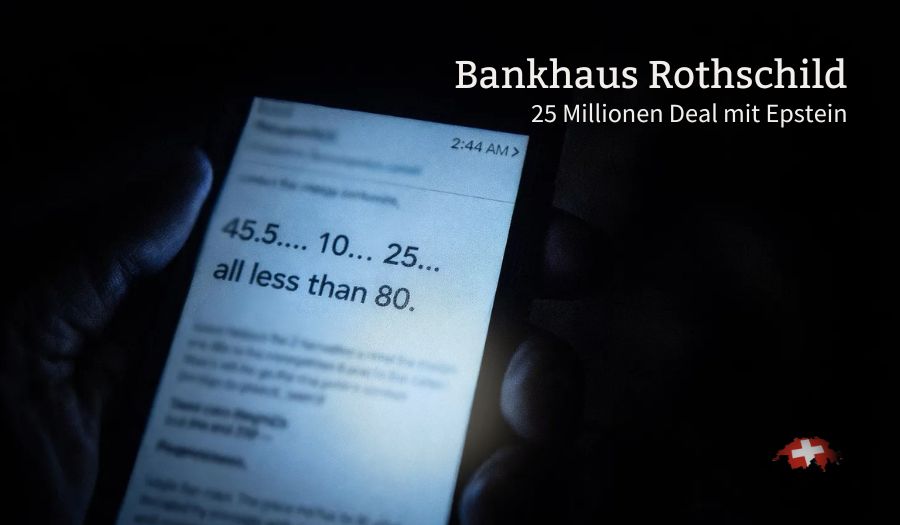







0 Comments