Neutralität ohne Souveränität
ist nur Verfassungslyrik
Der Schweizerische Verein WIR nimmt ausführlich Stellung zur Neutralitätsinitiative und erklärt, weshalb Neutralität ohne echte Souveränität ein leeres Versprechen bleibt
Offenbar haben wir mit unserem Artikel „Neutralität – die heilige Kuh der Schweiz“ in ein regelrechtes Wespennest gestochen. Eigentlich wollten wir nur die Frage in den Raum stellen, ob die Rüstungsstrategie des Bundesrats mit der angeblichen Schweizer Neutralität vereinbar ist. Doch dieser Aspekt ging bei vielen Lesern offenbar unter oder wurde geflissentlich ausgeblendet. Stattdessen wurden wir mit Rückmeldungen geflutet, wie es uns denn einfallen könne, die Neutralitätsinitiative zu kritisieren. Offenbar ist es leichter, sich über verletzte Symbole zu empören, als die unbequemen Fakten zu sehen. Umso mehr Anlass für uns, die gestellten Fragen offen zu beantworten.
Frage 1: Ist die Neutralität der Schweiz noch zeitgemäss oder wird sie zur leeren Formel? Wie sieht es der Schweizerische Verein WIR?
Zunächst: Der Ausdruck „heilige Kuh“ in unserem Artikel war bewusst gewählt. Denn Neutralität ist in der Schweiz nicht nur ein politisches Prinzip, sondern ein Mythos, ein identitätsstiftendes Narrativ, das seit Jahrzehnten gepflegt wird. Doch wie jede heilige Kuh schützt auch dieses Bild vor der nüchternen Wahrheit: Neutralität ist längst nicht mehr das, wofür sie ausgegeben wird. Doch wie wird sie überhaupt definiert?
- Offizielle juristische Definition der Neutralität
Die Neutralität der Schweiz ist keine eigenständige Verfassungsnorm, sondern ergibt sich aus verschiedenen Normen und Verpflichtungen:
- Art. 173 Abs. 1 lit. a BV: Der Bundesversammlung obliegt es, „Massnahmen zur Wahrung der äusseren Sicherheit, der Unabhängigkeit und der Neutralität der Schweiz“ zu treffen.
- Art. 185 Abs. 1 BV: Der Bundesrat trifft Massnahmen zur Wahrung der äusseren Sicherheit, Unabhängigkeit und Neutralität.
Das bedeutet: Neutralität ist verfassungsrechtlich verankert, aber nur als Auftrag an Regierung und Parlament, nicht als einklagbares Grundrecht.
- Völkerrechtliche Grundlage
Die völkerrechtliche Basis stammt aus dem Wiener Kongress (1815), wo die Schweiz als „in perpetuo neutra“, auf ewig neutral, deklariert wurde. Später folgte die Kodifizierung im Haager Abkommen von 1907 (V. und XIII.):
- Ein neutraler Staat darf keine Kriegspartei unterstützen (keine Waffenlieferungen, keine Durchmärsche von Truppen).
- Er darf sich aber verteidigen und eigene Streitkräfte unterhalten.
- „Immerwährende Neutralität“ – Mythos und Realität
Die Formel „immerwährend neutral“ war von Anfang an mehr eine diplomatische Konstruktion als eine eigenständige schweizerische Errungenschaft. Sie wurde den Eidgenossen von den Grossmächten zugeschrieben, weil man eine Pufferzone brauchte. Faktisch neutral war die Schweiz historisch nur in einem schmalen Zeitfenster von rund 33 Jahren (1815–1847). Danach wurde Neutralität zur Etikette und zum politischen Verkaufsargument, während die Praxis längst von wirtschaftlicher und militärischer Einbindung in den Westen geprägt war.
- Neutralität als „Instrument“
Der Neutralitätsbericht des Bundesrates von 1993 ist bis heute wegweisend. Dort wird Neutralität nicht als Dogma beschrieben, sondern als Instrument: „Neutralität ist kein Selbstzweck, sondern dient der Wahrung der Unabhängigkeit und der Handlungsfähigkeit der Schweiz.“
Damit hat man sich bewusst die Möglichkeit geschaffen, Neutralität flexibel auszulegen. Je nach politischem Druck oder internationalen Interessen kann sie eng oder weit interpretiert werden. Das ist praktisch für die Regierung, aber tödlich für das Vertrauen in eine klare, verlässliche Neutralität. Seit dem Neutralitätsbericht von 1993 gilt Neutralität offiziell nicht mehr als Dogma, sondern als Instrument. Ein Instrument aber wird politisch benutzt: mal so, mal so. Genau deshalb kann man in die Bundesverfassung schreiben, was man will: Am Ende bleibt es politisch beliebig interpretierbar.
Zum Wortlaut der Neutralitätsinitiative
Die Initiative schlägt folgenden Verfassungsartikel vor:
Art. 54a Schweizerische Neutralität
Abs. 1: „Die Schweiz ist neutral. Ihre Neutralität ist immerwährend und bewaffnet.“
Das klingt feierlich, ist aber tautologisch: Neutralität ist per Definition bewaffnet (Haager Abkommen 1907), und „immerwährend“ ist historisch eine Fremdzuschreibung von 1815. Juristisch hat dieser Satz null Mehrwert, weil er nichts Neues schafft. Er ist reine Verfassungslyrik.
Abs. 2: „Die Schweiz tritt keinem Militär- oder Verteidigungsbündnis bei. Vorbehalten ist eine Zusammenarbeit…“
Das ist bereits geltende Praxis: Die Schweiz ist nicht Mitglied der NATO, sehr wohl aber deren Partner (ITPP, PfP, Interoperabilität). Der Vorbehalt „Zusammenarbeit im Falle eines Angriffs“ ist ein Einfallstor, das jede Regierung politisch so weit auslegen kann, dass Kooperationen längst Realität sind. Kein Fortschritt.
Abs. 3: „Die Schweiz beteiligt sich nicht an militärischen Auseinandersetzungen… und trifft auch keine nichtmilitärischen Zwangsmassnahmen… Vorbehalten sind UNO-Verpflichtungen…“
Dieser Absatz sieht vor, dass Verpflichtungen gegenüber der UNO sowie Massnahmen zur Verhinderung der Umgehung fremder Sanktionen ausdrücklich vorbehalten bleiben. Damit öffnen die Initianten gleich zwei Schleusen: Erstens zwingt der UNO-Vorbehalt die Schweiz automatisch zur Mitwirkung an Sanktionen des Sicherheitsrats, die regelmässig von den Grossmächten durchgesetzt werden. Zweitens schafft die Klausel zur Umgehungsverhinderung eine Hintertür für EU- und US-Sanktionen. Genau das, was angeblich verhindert werden sollte. Anstatt die Grenze klar bei den UNO-Sanktionen zu ziehen, schreiben die Initianten die Aushöhlung der Neutralität selbst in den Verfassungstext. Damit wird das Gegenteil dessen erreicht, was versprochen wird.
Abs. 4: „Die Schweiz nutzt ihre immerwährende Neutralität für die Verhinderung und Lösung von Konflikten und steht als Vermittlerin zur Verfügung.“
Auch das ist keine neue Verpflichtung, sondern ein frommer Wunsch. Bereits jetzt beschreibt sich die Schweizer Diplomatie so. Faktisch bleibt unklar, wie dieser Absatz einklagbar oder bindend sein soll.
Fazit zur Neutralitätsinitiative
Wenn man sich an die juristische Definition hält, bleibt festzuhalten:
- Neutralität ist bereits in der Bundesverfassung verankert (als Auftrag).
- Sie ist völkerrechtlich anerkannt, aber von Beginn an fremdbestimmt gewesen.
- Politisch wird sie seit 1993 bewusst relativiert und instrumentalisiert.
- Der Initiativtext fügt nichts Substanzielles hinzu, sondern wiederholt und verwässert bestehende Regeln.
Die Folge: Der Wortlaut der eingereichten Verfassungsänderung ist aus unserer Sicht wirkungslos.
Warum? Er ändert nichts, die bestehenden Verpflichtungen gelten bereits. Die „immerwährende Neutralität“ ist historisch eine Legende, und die heutige Praxis macht sie zur leeren Formel. Solange Neutralität von Regierung und Parlament als flexibles Instrument verstanden wird (Neutralitätsbericht des Bundesrates von 1993), kann man in die Verfassung schreiben, was man will. Es bleibt am Ende politisch beliebig interpretierbar.
Kurz gesagt: Es ist aus unserer Sicht an der Zeit, der Realität ins Auge zu sehen, statt sich in Selbstlob zu üben und darauf zu verweisen, wie gut die Neutralität der Schweiz in der Vergangenheit angeblich funktioniert habe. Der aktuelle Initiativtext ist daher eine Papierformel. Nicht weil Neutralität abgeschafft werden soll, sondern weil Realität anerkannt werden muss: Neutralität funktioniert nur, wenn ein Land souverän ist und sie strikt durchsetzt. Die Schweiz ist seit dem Zweiten Weltkrieg aber faktisch nicht mehr souverän, zu eng ist sie in westliche Netzwerke eingebunden.
Eine Verfassungsänderung ohne Macht zur Durchsetzung ist nichts weiter als eine Beruhigungspille für die Öffentlichkeit. Zumal es kaum den Anschein hat, dass Bundespolitiker die Bundesverfassung wirklich gelesen hätten, geschweige denn, dass sie deren Einhaltung als ihre Pflicht begreifen. Auch hier zeigen sie sich sehr flexibel.
Frage 2: Welche Strategie könnte die Erfolgschancen einer Neutralitätsinitiative erhöhen?
Mit dem aktuellen Initiativtext ist aus unserer Sicht kein Erfolg möglich. Der Wortlaut ist schwammig, widersprüchlich und voller Hintertüren. Damit lassen sich weder die romantischen Befürworter noch die skeptischen Realpolitiker überzeugen. Die Gegner sind stark, gut vernetzt und haben ein klares Narrativ. Wer ernsthaft eine Chance haben will, muss zuerst einen präzisen, juristisch wasserdichten und politisch realistischen Text erarbeiten. Mit dem jetzigen Entwurf bleibt die Initiative Verfassungslyrik und Verfassungslyrik gewinnt in der Regel keine Abstimmungen in der Schweiz.
Für den gewöhnlichen Stimmbürger erschliesst sich aus diesem Wortlaut keinerlei konkrete Verbesserung: Was wie feierliche Prosa klingt, bleibt politische Poesie ohne praktischen Nutzen.
Vorbemerkung zur Verzögerung
Die aktuelle Verzögerung erklärt sich daraus, dass die Aussenpolitische Kommission des Nationalrates (APK-N) beschlossen hat, den vom Ständerat verabschiedeten direkten Gegenentwurf zur Neutralitätsinitiative in die Vernehmlassung zu schicken. Das ist durchaus gängige Praxis: Für die Volksinitiative selbst gibt es keine Vernehmlassung, wohl aber für Gegenentwürfe. Auf diese Weise werden Kantone, Parteien und Verbände um Stellungnahmen gebeten. Dieses Verfahren führt zwangsläufig zu Verzögerungen, weil zunächst alle Rückmeldungen ausgewertet werden müssen, bevor die Vorlage weiterbearbeitet wird. Solche Abläufe sind nichts Ungewöhnliches, sie haben auch bei früheren Initiativen stattgefunden und werden regelmässig eingesetzt. Faktisch jedoch verschiebt sich dadurch der Abstimmungstermin um mindestens ein Jahr.
Für Aussenstehende wirkt dieses Verfahren reichlich absurd – Initiative, Gegenentwurf, Stichfrage –, für die Schweizer Politik ist es jedoch Standard und gilt als Teil des Kompromiss-Handwerks.
Frage 3: Wem nützt die Verzögerung des Abstimmungstermins?
Darauf gibt es eine einfache Antwort: Ein schwacher Text wird durch Abwarten nicht besser. Verzögerung ist kein Reifungsprozess, sondern ein Geschenk an die Gegner. Während die Initianten hoffen, dass ihre Leerformeln durch Zeit an Gewicht gewinnen, bauen die Gegner in Ruhe ihre Kampagne aus. Die Befürworter hingegen verlieren an Dynamik und verheddern sich weiter in internen Spaltungen. Wer glaubt, ein schwacher Initiativtext werde durch Aufschub besser, verwechselt Politik mit Kellerlagerung.
Und der Gegenvorschlag? Noch weniger Substanz!
Der vom Ständerat verabschiedete direkte Gegenentwurf bringt keine Klärung, sondern verwässert die Sache noch weiter:
Abs. 1: „Die Schweiz ist neutral. Ihre Neutralität ist immerwährend und bewaffnet.“
Eins-zu-eins die gleiche tautologische Prosa wie im Initiativtext. Kein Mehrwert, keine Präzisierung.
Abs. 2: „Der Bund nutzt die Neutralität, um die Unabhängigkeit und Sicherheit der Schweiz zu gewährleisten, Konflikte zu verhindern oder zur Lösung von Konflikten beizutragen. Er steht als Vermittler zur Verfügung.“
Auch das ist pure Verfassungslyrik. „Nutzen“ ist ein Gummibegriff, der exakt die 1993er Instrumentenlogik fortschreibt: Neutralität wird nicht als klare Verpflichtung definiert, sondern als Werkzeug, das nach Belieben eingesetzt werden kann.
- „Konflikte verhindern“ kann alles heissen: von UNO-Sanktionen über NATO-Manöver bis hin zu Waffenexporten „zur Stabilisierung“.
- „Zur Lösung beitragen“ klingt nett, ist aber eine Leerformel.
- Die Rolle als Vermittler ist ohnehin längst Teil der Schweizer Diplomatie.
Wenn die Neutralitätsinitiative Symbolpolitik ist, dann ist der Gegenentwurf politische Dekoration ohne jede Bindungskraft. WIR halten von diesem Gegenvorschlag noch weniger, weil er nicht einmal den Versuch unternimmt, Grenzen zu setzen. Er ist das perfekte Beispiel für eine Leerformel, die sich zwar schön liest, aber keinerlei praktische Wirkung entfaltet.
Abschliessende Bemerkungen
So sähe Neutralität ohne Hintertüren aus unserer Sicht aus:
Ein Verfassungstext mit Substanz müsste:
- klare Verbote enthalten (keine Waffenlieferungen, keine Sanktionen ausserhalb der UNO, keine militärische Kooperation mit der NATO),
- einklagbar formuliert sein (Pflichtnorm, nicht nur Programmsatz),
- keine Gummiklauseln enthalten wie den UNO-Vorbehalt, der das Ganze aushöhlt.
Exkurs: Der UNO-Vorbehalt als Feigenblatt
Die Initianten behaupten, Neutralität zu sichern, und bauen gleichzeitig den UNO-Vorbehalt ein. Dazu noch den Zusatz, die Schweiz müsse Massnahmen zur Verhinderung der Umgehung fremder Sanktionen übernehmen. Damit wird der Kern selbst ausgehebelt: Was als „immerwährende Neutralität“ verkauft wird, ist in Wahrheit die Hintertür für EU- und US-Sanktionspolitik.
Wichtig ist die Differenzierung: Sanktionen des UNO-Sicherheitsrats sind völkerrechtlich zwingend, sie gehören zur Mitgliedschaft. Alles darüber hinaus – EU-Sanktionen, US-Sanktionen, „Koalitionen der Willigen“ – ist politischer Opportunismus. Ein sauber formulierter BV-Text müsste genau diese Grenze ziehen: nur UNO-Sicherheitsrat, nichts weiter.
Damit wäre klar, dass Neutralität nicht einseitig geopfert wird, sondern im Rahmen des Völkerrechts verlässlich bleibt.
Beispielhaft könnte er lauten:
„Die Schweiz beteiligt sich weder direkt noch indirekt an militärischen Konflikten anderer Staaten und übernimmt keine Sanktionen oder Massnahmen, die über die Beschlüsse des Sicherheitsrates der UNO hinausgehen.“
Damit wäre wenigstens klar, wo die Grenze verläuft. Alles andere bleibt politische Dekoration.
Das eigentliche Problem: fehlende Souveränität
Doch selbst ein wasserdichter Verfassungstext bleibt ein Papiertiger, solange die Schweiz faktisch nicht souverän ist. Wer glaubt, Neutralität sei allein durch eine BV-Formulierung gesichert, ignoriert die Realität:
- Die CIA betreibt ihre Europazentrale in Bern.
- In Genf residiert ein ganzer Komplex internationaler Organisationen (UNO, WHO, WTO), die faktisch Politik mitbestimmen, ohne demokratische Legitimation.
- Die NATO sitzt im „Haus des Friedens“ in Genf und geniesst die Privilegien des Gaststaatgesetzes.
- Die Schweiz ist tief in NATO-Programme, EU-Standards und internationale (transatlantische) Netzwerke eingebunden.
Insofern liegt es doch für alle ersichtlich offen auf dem Tisch: Neutralität und Souveränität sind in der heutigen Schweiz reine Fiktion. Ein Verfassungstext allein ändert daran nichts. Solange die CIA ihre Europazentrale in der Schweiz betreibt, internationale Organisationen in Genf mit Immunität Politik mitbestimmen, die NATO in Genf privilegiert residiert und die Schweiz tief in NATO-Programme sowie EU-Standards eingebunden ist, bleibt Neutralität ein Mythos. Ohne Rückgewinnung echter Souveränität ist jede neue Verfassungsbestimmung ein Selbstbetrug. Ein Versprechen ohne Wirkung.
Dass es der Schweiz an Souveränität fehlt, zeigt sich nicht nur in der Aussen- und Sicherheitspolitik. Auch im Finanzbereich war es sichtbar: Hätte die Schweiz noch echte Souveränität, gäbe es die Credit Suisse (CS) noch. Die Zerschlagung der CS war weniger ein gewöhnlicher Bankrott als eine geopolitisch erzwungene Operation, bei der internationale Akteure, allen voran US-Behörden und transatlantische Regulatoren, den Ton angaben und der Bundesrat folgte. Genau darin liegt das Problem: Wo Souveränität fehlt, sind Neutralität und entsprechende Verfassungstexte nur beschriebenes Papier.
Das zu erkennen, fällt nicht leicht. Es widerspricht vielem, was uns jahrzehntelang eingeprägt wurde. Doch nur wer die Realität anerkennt, kann den Weg zu echter Souveränität finden.



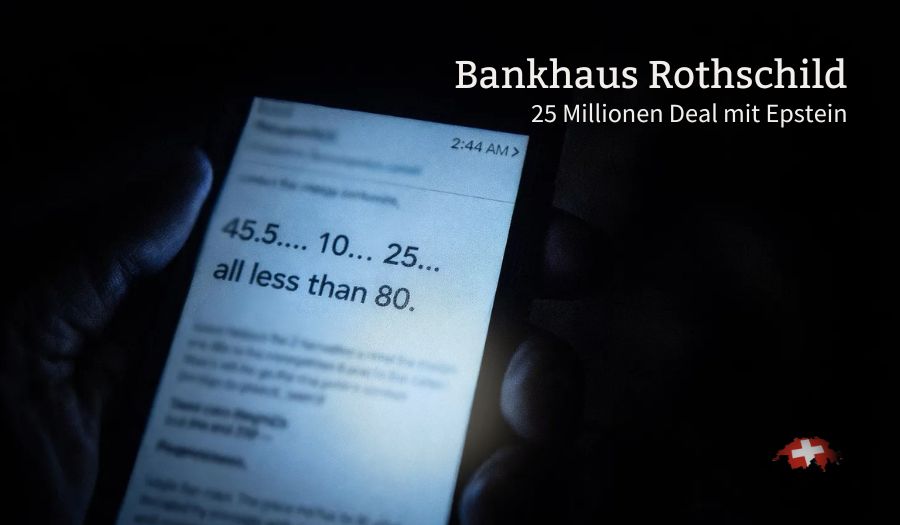







Das sehe ich ganz genau so. Die Neutralitätsinitiative ist im besten Fall wirkungslos. Im schlechteren Fall ist sie sogar ein Einfallstor für weitere Aufweichungen der Neutralität, indem man Ausnahmen ausdrücklich in die Verfassung aufnimmt und dann eine demokratische Legitimation unterstellen kann. Ich habe dazu bei Christoph Pfluger selbst einen Artikel publiziert. Ich weise darauf hin, dass unsere Neutralität auch von wirtschaftlichen Abhängigkeiten unterlaufen wird: https://zeitpunkt.ch/ueber-den-wert-der-neutralitaet-der-schweiz-und-ihre-voraussetzungen