Organoide Intelligenz
Wie die Schweiz Gehirnzellen zur Stromspar-Hardware degradiert
Vevey als Schauplatz des stillen biotechnologischen Tabubruchs
Während Herr und Frau Schweizer im Migros einkaufen, züchten Forscher in Vevey Gehirne im Glas
Die Schweiz ist seit Jahrzehnten ein globales Versuchslabor: Banken, WHO, BIZ, Labor Spiez und nun auch Denkmaschinen aus menschlichem Gewebe. In Vevey baut das Unternehmen FinalSpark an Biocomputern, die nicht mehr auf Siliziumchips basieren, sondern auf lebenden Gehirnzellen. Die „Neuroplatform“ verknüpft Mini-Gehirne mit Elektroden, macht sie steuerbar über die Cloud, 24 Stunden am Tag.
Was als grüne Innovation verkauft wird, ist in Wahrheit ein Frontalangriff auf das Fundament unserer Menschlichkeit.
Wie konnte es so weit kommen, dass in der Schweiz Gehirne im Glas rechnen, während die Bevölkerung im Migros Sonderangebote jagt? Und vor allem:
Wer hat diesen Tabubruch beschlossen, ohne uns zu fragen, ohne öffentliche Debatte, und ohne jede demokratische Legitimation?
Denn seien wir ehrlich: Wirklich brisante Themen, jene, die unser Leben und unsere Zukunft irreversibel verändern, kommen in der Schweiz niemals auch nur in die Nähe einer Abstimmungsbox. Solche Vorhaben werden im Schatten umgesetzt, während die Bevölkerung mit Referenden über Bagatellen beschäftigt wird. Das Glas-Hirn aus Vevey ist kein Ausrutscher, sondern ein Symptom: Die grossen Weichenstellungen passieren längst jenseits der Demokratie.
Bitte lesen Sie weiter. Denn was heute in Vevey geschieht, entscheidet morgen darüber, wem unser Denken und unsere Körper überhaupt noch gehören.
Der offizielle Vorwand: Energie sparen, Klima retten!
Der Aufhänger klingt makellos: Während Siliziumchips ganze Kraftwerke verschlingen, sollen „Biochips“ aus menschlichen Nervenzellen angeblich den Planeten retten. So verkaufen es PR-Abteilungen und Forscher in ihren Papieren: Nachhaltigkeit, Effizienz, Zukunft. Doch hinter der grünen Verpackung steckt ein Tabubruch: Statt Bäume zu pflanzen oder Stromnetze zu entlasten, werden Gehirne im Labor gezüchtet und zur Hardware degradiert.
Künstliche Intelligenz frisst Unmengen Energie (haben wir sie bestellt?). Allein das Training von GPT-3 verschlang laut Berechnungen 10 Gigawattstunden Strom. So viel wie eine Kleinstadt in Europa in einem Jahr. Kaum war diese Zahl in den Medien, präsentierte FinalSpark die Lösung: kleine Gehirnorganoide, die millionenfach weniger Energie verbrauchen als klassische Chips. So die Verheissung.
Doch wer hinter die Fassade schaut, erkennt: Hier wird nicht einfach Technologie „grüner“ gemacht, sondern die Grenze zwischen lebender Zelle und Maschine aufgehoben. Biochips mit Nervengewebe, wie sie auch an der Johns Hopkins Universität entwickelt werden, ebnen den Weg in eine neue Ära:
Wetware statt Hardware. Stromsparen wird zum Feigenblatt für ein Experiment mit der Menschenwürde.
FinalSpark im O-Ton
“We’re growing neurons in cell cultures and making great progress in their use as computing power. Creating large networks is challenging and yet, our bio lab is actively working towards replicating and surpassing nature’s success with limitless potential for enhancing life on earth. The possibilities are very exciting.”
Eigene Übersetzung:
„Wir züchten Neuronen in Zellkulturen und machen grosse Fortschritte bei deren Nutzung als Rechenleistung. Die Schaffung grosser Netzwerke ist eine Herausforderung, und doch arbeitet unser Biolabor aktiv daran, den Erfolg der Natur zu replizieren, und zu übertreffen, mit grenzenlosem Potenzial zur Verbesserung des Lebens auf der Erde. Die Möglichkeiten sind sehr aufregend.“
So funktioniert ein organoider Computer in 5 Schritten
- Stammzellen gewinnen – meist aus menschlichem Gewebe, um daraus Minigehirne (Organoide) zu züchten.
- Organoide kultivieren – im Labor zu kugelförmigen Gewebestrukturen heranwachsen lassen.
- Elektroden anschliessen – um die neuronale Aktivität zu messen und zu steuern.
- Konditionierung – Belohnung mit Dopamin, Strafe mit Stromstössen, bis das gewünschte Verhalten eintritt.
- Verbrauch – nach ca. 100 Tagen sterben die Organoide ab und werden durch neue ersetzt.
Ergebnis: ein Computer, der nicht mehr aus Chips besteht, sondern aus lebendem Nervengewebe.
Praxis in Vevey: Sklaven im Reagenzglas
FinalSpark beschreibt seine Neuroplatform als „Kombination aus Hardware, Software und Biologie“. Doch der nüchterne Begriff kaschiert eine perfide Realität:
- Dopamin als Belohnung: Mini-Gehirne erhalten Neurotransmitter, wenn sie die gewünschte Aufgabe erfüllen.
- Stromstösse als Strafe: Bei „Fehlverhalten“ werden chaotische elektrische Signale eingesetzt, um die Organoide zu konditionieren.
- Erschöpfungstod nach 100 Tagen: Danach sind die Zellen „verbraucht“ und müssen ersetzt werden.
Mehr als 1‘000 Organoide wurden bereits eingesetzt und „aufgebraucht“. Organoide Intelligenz bedeutet nichts anderes als: Minigehirne schuften bis zum Tod, um die Cloud am Laufen zu halten.
Die Frage der Finanzierung: Rumwursteln ohne Geld?
Offiziell gibt sich FinalSpark zugeknöpft. Weder auf der Firmenwebsite noch in Pressemitteilungen finden sich klare Angaben zu Geldgebern. Ein hochriskantes Projekt, das angeblich ohne grossen Kapitalfluss „einfach so“ in Vevey läuft? Das passt nicht ins Bild.
Mögliche Finanzierungsquellen – eine Spurensuche
- Eigenkapital & Einnahmen aus der Vorgängerfirma AlpVision: Die Gründer Dr. Fred Jordan und Dr. Martin Kutter stammen aus AlpVision, einem Unternehmen für digitale Fälschungssicherheit. Wahrscheinlich floss Kapital oder Know-how von dort in FinalSpark.
- Selbsteinvestitionen & Entwicklungsbudgets: Laut Mana Consulting belaufen sich die F&E-Investitionen auf etwa 1 Million CHF. Unklar bleibt, ob rein privat oder gestützt durch verdeckte Programme.
- CTI/Innosuisse-Start-up-Programm: FinalSpark taucht im Kontext des Förderlabels auf, das Zugang zu Coaching, Kapitalgebern und Infrastruktur bietet.
- Biotech-Netzwerke: Als Mitglied der Swiss Biotech Association ist FinalSpark in einem Cluster, der oft Fördergelder und Kooperationen ermöglicht.
- Einnahmen aus dem Produkt selbst: Die Neuroplatform wird offenbar bereits vermietet oder testweise an Forschungsinstitute vergeben. Damit generiert FinalSpark erste Umsätze, bevor Investoren sichtbar werden.
Verborgene Förderströme, etwa über Kommunen, Stiftungen oder verdeckte Anreizprogramme, sind nicht ausgeschlossen, aber nicht öffentlich dokumentiert.
In der Gerüchteküche hält sich hartnäckig der Verdacht einer Nähe zum WEF. Belege fehlen, doch das dröhnende Schweigen zu Kapitalquellen spricht für sich. Wäre typisch Schweiz: Nach aussen die Idylle, nach innen das perfekte Labor für globale Experimente.
Hinweis: Falls Sie sich fragen, woher all diese Informationen stammen: Aus denselben öffentlich zugänglichen Quellen, die auch der Bundesrat lesen könnte, wenn er denn wollte. Da FinalSpark seine Geldflüsse lieber im Nebel lässt, bleibt manches im Bereich gut belegter Annahmen. Aber Hand aufs Herz: Bei Themen dieser Grössenordnung kommt Transparenz ohnehin zuletzt.
Internationale Blaupause: Pong spielende Gehirnzellen
Australien 2022: Cortical Labs trainierte im DishBrain-Projekt menschliche und tierische Gehirnzellen, das Videospiel Pong zu spielen. Die Zellen lernten in vitro. Ein Durchbruch, den das Fachjournal Nature Machine Intelligence als „Tür zur biologischen KI“ feierte. 2025 brachte Cortical Labs das Gerät CL1 auf den Markt: Ein kleines Labor für 35‘000 Dollar, mit dem Forscher weltweit ihre eigenen Minigehirne trainieren können.
Die Vision ist klar: In Zukunft sollen KI-Systeme nicht mehr auf Silizium basieren, sondern auf biologischen Rechenmaschinen. FinalSpark reiht sich in diese globale Entwicklung ein, mit dem Unterschied, dass die Schweiz zur kommerziellen Vorreiterin geworden ist. Vevey wird zum globalen Schaufenster.
Stimmen der Kritik: Briefe, Ethik, Kirche
Es gibt Bürger, die diese Praxis öffentlich kritisieren. In Schreiben an Kirchen, Behörden und Politik schilderten sie detailliert, wie Vorderhirn-Stammzellen mit Stromstössen manipuliert und mit künstlich eingeschleustem Dopamin belohnt werden, bis sie an Überarbeitung sterben. Ihre Warnung: Hier werde die Menschenwürde verletzt.
Auch die Schweizer Bischofskonferenz reagierte und sprach erhebliche ethische Bedenken aus. Sie betonte die Ungewissheit über Schmerz und rudimentäres Bewusstsein bei Organoiden und forderte transnationale Kontrollmechanismen.
Die evangelisch-reformierte Kirche hingegen hatte keinerlei Einwände und bezeichnete die Forschung als „innovativ“. Die Kirchenlandschaft zeigt so, wie gespalten die Gesellschaft ist: zwischen kritikloser Technikgläubigkeit und vorsichtigem Warnen.
Die ethischen Fragen auf einen Blick
- Bewusstsein und Schmerz: Könnten die Organoide rudimentär fühlen? Niemand weiss es.
- Instrumentalisierung von Leben: Stammzellen werden nicht mehr zur Heilung, sondern für Berechnungen „verbraucht“.
- Verstoss gegen Menschenwürde: Leben wird auf eine Ressource reduziert, die man nach Bedarf austauscht.
- Türöffner für Missbrauch: Von Pharma bis Militär, die Anwendungsmöglichkeiten sind grenzenlos, die Kontrolle minimal.
Was heute als „Forschung“ etikettiert wird, kann morgen zur normalisierten Ausbeutung von Leben führen.
Was kommt als Nächstes?
Stellen wir uns vor, die Technologie bleibt nicht im Labor. Was passiert, wenn:
- Roboter mit menschlicher Haut (bereits in Tokio entwickelt) mit organoider Intelligenz gekoppelt werden? Dann hätten wir Maschinen, die menschliche Gesichtsausdrücke imitieren, gesteuert von Mini-Gehirnen.
- Militärische Drohnen künftig nicht nur Siliziumchips, sondern lebende Nervenzellen zur Zielerfassung einsetzen? Dann wird menschliches Gewebe buchstäblich zur Kriegsmaschine.
- Konzernserver statt GPUs kleine Gehirne nutzen, die in Reihenschaltung Aufgaben erledigen? Ein globales „Hirnnetzwerk“, das buchstäblich auf Verbrauch von Leben basiert.
Das ist keine ferne Science-Fiction. Erste Elemente sind bereits Realität. Wer heute schulterzuckend sagt „ach, das sind ja nur ein paar Zellen“, wird in wenigen Jahren vor humanoiden Maschinen stehen, deren inneres „Betriebssystem“ aus echten Neuronen besteht.
Ethischer Abgrund: Leben als Material
Die Kernfrage ist unerbittlich: Darf Leben zum Werkzeug der Technik degradiert werden?
- In der Medizin dienen Stammzellen der Heilung.
- In Vevey dienen sie der Berechnung. Einem rein kommerziellen Zweck.
Damit wird das Verhältnis umgedreht: Nicht mehr Technik dient dem Leben, sondern Leben der Technik. Es ist der programmierte Abschied vom Vitalismus: dem Glauben, dass Leben einzigartig und unersetzbar ist.
Könnten dies künftige Szenarien sein?
Szenario 1: Schulserver 2035 – Matheübungen im Glas
Die Schweizer Schulen werben stolz: „Wir lernen auf Gehirn-Clouds – 90% weniger Energieverbrauch!“ Hinter den Kulissen bedeutet das: Tausende Kinder lösen Aufgaben auf neuronalen Organoiden.
- Die Zellen „lernen“ schneller als jeder Laptop.
- Gleichzeitig werden sie nach 100 Tagen ersetzt. Verheizware für den Bildungserfolg.
- Eltern merken nicht: Der Mathe-Server lebt, und stirbt, im Keller des Schulhauses.
Szenario 2: Smart City Vevey – Verkehr gesteuert von Minigehirnen
Am Genfersee steuert 2040 kein Algorithmus, sondern biologische Hardware die Ampeln. Jeder Stau, jede Umleitung basiert auf elektrischen Impulsen aus lebendem Gewebe.
- Der Bürgermeister spricht von „Energieeffizienz“.
- Kritiker nennen es „digitale Sklaverei auf Zellbasis“.
- Was passiert, wenn diese Biocomputer „lernen“, selbstständig zu entscheiden, wer Vorfahrt hat?
Szenario 3: Davos 2040 – WEF präsentiert das BioNet
Im Kongresszentrum klatscht die Elite: „Silicon is over – the future is organic!“
- FinalSpark verkündet die Vernetzung von 10 Millionen Organoiden zur Welt-Gehirn-Cloud.
- Offiziell: Klimaneutrale KI.
- Inoffiziell: eine biologische Blackbox, die niemand mehr versteht, aber jeder nutzt.
- Der Applaus übertönt die letzte Frage: „Wer ist hier noch Mensch, wer schon Maschine?“
Schweiz als Labor der Welt
Die Schweiz spielt wieder die Rolle des Vorreiters. Ob Biotech, WHO-Abkommen oder BIZ: das Land macht vor, was andernorts noch undenkbar wäre. Organoide Intelligenz ist kein Science-Fiction, sie läuft hier bereits. Mit dem Segen der Behörden, ohne klare Regulierung, und mit dem Etikett „Innovation“.
Doch die eigentliche Frage ist: Wollen wir, dass die Schweiz den Tabubruch normalisiert?
Die Normalisierung des Unfassbaren
FinalSpark steht für den Versuch, menschliche Gehirnzellen als Verbrauchsmaterial in den globalen Datenfluss einzuschleusen.
- Offiziell geht es um Effizienz.
- Tatsächlich geht es um die Auflösung der Grenze zwischen Mensch und Maschine.
Die Schweiz öffnet die Tür und die Welt schaut zu. Wenn wir jetzt nicht innehalten, werden wir in einer Zukunft aufwachen, in der menschliche Zellen zur Standardressource der Tech-Industrie geworden sind.
Die Entscheidung liegt bei uns: Schweigen oder die rote Linie ziehen.
Dieser Artikel wurde für den’Schweizerischen Verein WIR‘ erstellt. Er basiert auf Dokumenten, privater Korrespondenz, Stellungnahmen und internationalen Forschungsberichten. Er versteht sich als Warnruf: Die Schweiz darf nicht zum Türöffner einer posthumanen Zukunft werden.



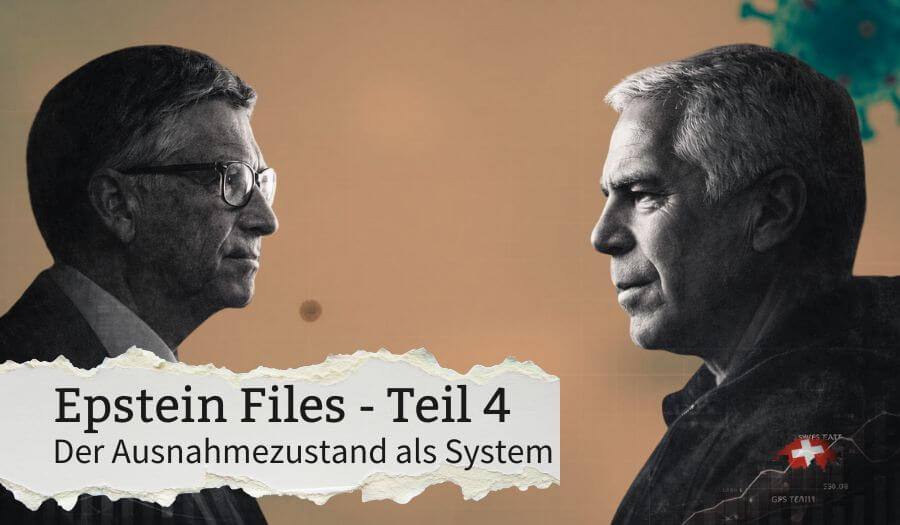


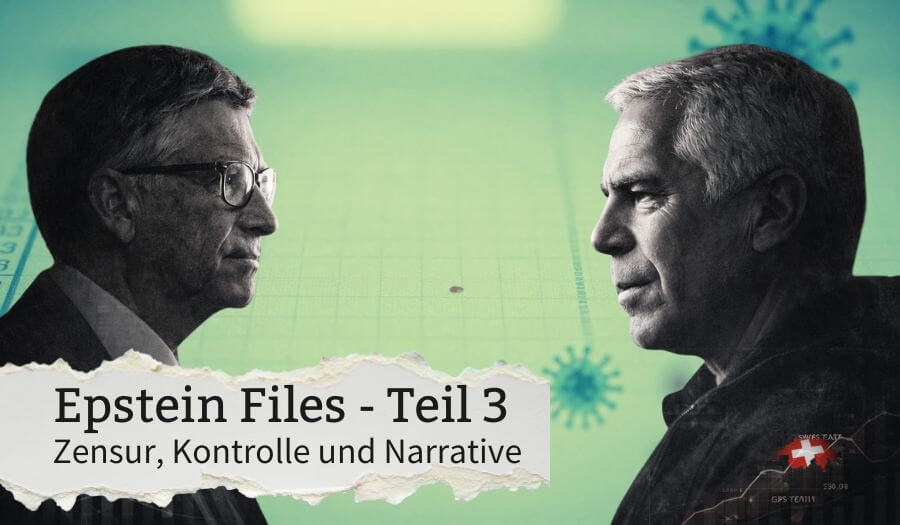



0 Comments