Resilient in den Abgrund:
Die stille NATO-Durchdringung der Schweiz
Basierend auf Enthüllungen von Norbert Häring
Norbert Häring enthüllt in einem brisanten Artikel vom 23. Juni 2025, wie tief die NATO ihre Finger in der zivilen Regierungspolitik ihrer Mitglieds- und Partnerländer hat. Nicht nur Militär, sondern auch Gesundheit, Klima, Medien, Infrastruktur und sogar Migration werden mittlerweile unter dem Label „Resilienz“, oder besser: Wehrhaftigkeit, als sicherheitsrelevant eingestuft. Das besonders Pikante: Die NATO arbeitet dabei mit geheimen Vorgaben. In den Niederlanden kam durch Informationsfreiheitsanfragen ans Licht, dass Ministerien an geheimen NATO-Zielen ausgerichtet werden, ohne Einbindung der Parlamente. Häring zeigt, wie unter dem Deckmantel der „Resilienz“ eine Entmachtung der Demokratie droht. Und er belegt: Auch Deutschland macht mit. Und die Schweiz?
Die Schweiz macht bei der NATO-Resilienz-Agenda auch mit. Punkt.
Offiziell gibt sich die Schweiz „neutral“. Doch de facto sitzt sie längst mit im NATO-Boot.
Seit 2023 läuft das sogenannte „Individually Tailored Partnership Programme“ (ITPP). Eine massgeschneiderte Zusammenarbeit mit der NATO. Der Name klingt wie ein spassfreies Gesundheitsabo, ist aber in Wirklichkeit ein Einfallstor für militärstrategisch motivierte Einflussnahme auf zentrale Bereiche der Schweizer Innenpolitik.
Das ITPP listet konkret auf, worum es geht: Cybersicherheit, Schutz kritischer Infrastrukturen, Gesundheitsmanagement, Krisenkommunikation und, besonders heikel, Desinformationsbekämpfung. Was letzteren Punkt betrifft: Wer definiert eigentlich, was Desinformation ist? Richtig, dieselben Institutionen, die die Macht haben, unliebsame Wahrheiten zur Gefahr zu erklären.
Die Schweiz liefert im Rahmen des ITPP nicht nur Daten an NATO-Gremien, sondern trainiert aktiv zivil-militärische Szenarien, wohlgemerkt unter Anleitung und mit Methoden, die direkt aus NATO-Doktrinen stammen. Was früher eine eigenständige Milizarmee war, wird heute Schritt für Schritt in ein kompatibles Zahnrad der transatlantischen Sicherheitsarchitektur verwandelt. Die Übungen reichen von Cyberangriffen auf kritische Infrastruktur bis hin zu Desinformations- und Migrationsszenarien. Alles, was man braucht, um „Resilienz“ als neuen Sicherheitsimperativ auszurufen. Ziel ist nichts Geringeres als eine kriegstüchtige Gesellschaft. Ein Begriff, den man sich besser zweimal auf der Zunge zergehen lässt, bevor man merkt, dass das kein Verteidigungskonzept mehr ist, sondern ein Gesellschaftsumbau auf leisen Sohlen.
Geheimverträge? Die Debatte ist längst da.
Was einst General Henri Guisan im Zweiten Weltkrieg im Verborgenen regelte, erlebt heute eine bemerkenswerte Renaissance: sogenannte Punktationen. Dabei handelt es sich um geheime, nicht bindende Abmachungen, in der Regel militärischer Natur, die den Krisen- oder Kriegsfall vorweg regeln, ohne parlamentarische Kontrolle.
Historisch belegt ist, dass Guisan ab Herbst 1939 in geheimen Gesprächen mit dem französischen Generalstab vereinbarte, dass Teile der Schweizer Armee im Ernstfall unter französisches Kommando gestellt würden, eine stillschweigende Allianz, um das Land gegen eine mögliche deutsche Invasion zu schützen. Diese Vereinbarungen blieben dem Bundesrat oder Parlament weitgehend unbekannt und wurden erst später durch Dokumente aus französischen Archiven sichtbar .
Laut dem Bericht der von Viola Amherd geleiteten Studienkommission vom August 2024, veröffentlicht im SonntagsBlick, diskutiert die Schweiz erneut über solche „diskreten“ Absprachen mit der NATO. Im Fokus steht die Frage, wie sich die Schweiz im Krisenfall verhalten würde, beispielsweise bei einem Cyberangriff auf ein NATO-Land oder bei Sabotage kritischer Infrastrukturen. Offiziell ist von „keinen Gesprächen mit dem NATO-Hauptquartier“ die Rede. Doch inoffiziell sei klar: Die NATO erwarte, dass die Schweiz keine Sicherheitslücke bildet, insbesondere nicht bei Energie, Finanzen oder Kommunikation.
Der 5%-Trick:
Wie sich die NATO in die Innenpolitik einkauft
Am NATO-Gipfel am 24./25. Juni 2025 in Den Haag wurde ein neues Ziel beschlossen: Die Staaten sollen künftig 5 % ihres BIP für „Verteidigung“ ausgeben. Doch der Trick steckt im Detail: 3,5% sind für klassische Rüstung gedacht, 1,5% für „militärisch relevante Infrastruktur“. Und was ist das? Alles, was der NATO in den Kram passt: Stromnetze, digitale Kommunikationswege, Medienlandschaften, ja sogar Faktenchecker. Wenn man das nationale Stromnetz NATO-ready macht oder Plattformen zur Desinformationsbekämpfung finanziert, zählt das künftig als Rüstungsausgabe.
Damit wird klar: Die NATO definiert nicht nur, was ein Risiko ist. Sie bestimmt auch, wie Regierungen auf diese Risiken zu reagieren haben: mit Geld, Gesetzen und Strukturen. Nicht mit Panzern, sondern mit politischen Vorgaben. Ein Anreizsystem, das sich tief in nationale Entscheidungsprozesse frisst.
Die Schweiz, wie sie wirklich handelt
Während in der Öffentlichkeit von Neutralität gesprochen wird, wird hinter den Kulissen längst synchronisiert, angepasst und abgestimmt, entlang der NATO-Vorgaben. Das zeigt sich besonders deutlich in der sicherheitspolitischen Infrastruktur, die unter Federführung des VBS sukzessive umgebaut wurde: Cybersicherheit, Bevorratung, Krisenvorsorge und Kommunikationssteuerung sind längst nicht mehr nur nationale Themen, sondern folgen dem Drehbuch der „Resilienz“, wie es in den NATO-Dokumenten definiert wird.
Das Bundesamt für Cybersicherheit (BACS), offiziell zuständig für Schutz und Verteidigung im digitalen Raum, agiert faktisch als Schnittstelle zwischen Verwaltung, Wirtschaft und internationalen Sicherheitspartnern. Es dient nicht nur der internen Gefahrenabwehr, sondern auch der Einbindung in multilaterale Netzwerke, insbesondere dort, wo „hybride Bedrohungen“ identifiziert werden. Begriffe wie „gesellschaftliche Resilienz“, „kritische Infrastrukturen“ und „strategische Kommunikation“ stammen längst nicht mehr aus Bern, sondern spiegeln das Vokabular der NATO-Agenda.
Konferenzen, Studien und Strategiepapiere wie die „Nationale Cyberstrategie“ oder das neue Sicherheitsdispositiv im Bevölkerungsschutz verankern die neuen Standards zunehmend tief im Landesinnern, ohne dass eine breite demokratische Debatte darüber stattgefunden hätte. Dass sich diese Programme auffällig oft mit NATO-Veröffentlichungen decken, ist kein Zufall, sondern Ausdruck eines politischen Willens zur stillen Annäherung. Es ist eine Resilienzstrategie mit doppeltem Boden: nach aussen kooperationsbereit und „neutral“, nach innen sicherheitskompatibel und transatlantisch eingebettet.
Die grosse demokratische Debatte dazu? Fehlanzeige.
Im Schatten des NATO-Resilience Committee
Auch wenn die Schweiz offiziell kein NATO-Mitglied ist, könnte sie auch in die Aktivitäten des NATO Resilience Committee (RC) eingebunden sein. Dieses 2022 gegründete Gremium gilt als oberste strategische Instanz für alle zivilen Resilienzthemen innerhalb des Bündnisses. Es koordiniert die Umsetzung der Resilienzziele aus dem „Strengthened Resilience Commitment“, der NATO-Agenda 2030 und dem Strategischen Konzept 2022, inklusive deren Übersetzung in nationale Politikbereiche.
Das RC könnte somit auch in der Schweiz indirekt Wirkung entfalten, etwa durch die Implementierung von Konzepten, die dort strategisch entwickelt werden: Widerstandsfähigkeit der Energieversorgung, Desinformationsbekämpfung, Aufrechterhaltung der Regierungsfunktionen in Krisenzeiten, Versorgungssicherheit bei Lebensmitteln oder Mobilität im Verteidigungsfall. Auch die vielzitierte „gesellschaftliche Resilienz“, verstanden als Unterstützung oder Duldung regierungskonformer Politik durch die Bevölkerung , dürfte in den Zielhorizont dieses Komitees fallen.
Da das RC nicht nur mit Mitgliedstaaten, sondern regelmässig auch mit Partnerländern zusammenarbeitet, wäre es denkbar, dass die Schweiz über offizielle Delegationen oder thematische Arbeitsgruppen eingebunden ist. Dies könnte etwa über das Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BABS), das Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung (BWL) oder das Bundesamt für Cybersicherheit (BACS) erfolgen. Die Schweiz unterstützt zudem das dem RC unterstellte Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre (EADRCC), was auf operative Kooperation hinweisen könnte, insbesondere bei Übungen, Lageanalysen oder technischen Abstimmungen.
Auch die Tatsache, dass das RC sechs hochspezialisierte Planungseinheiten zu Bereichen wie Kommunikation, Energie, Transport, Gesundheit, Ernährung und Bevölkerungsschutz betreibt, legt nahe, dass bestehende schweizerische Fachstrukturen, selbst ohne formelle NATO-Zugehörigkeit, an gewisse Standards oder Prioritäten angepasst werden könnten. Im Rahmen von Partnerformaten wie der jährlich stattfindenden Plenarsitzung auf Ebene der Policy Directors oder über projektbezogene Beteiligung könnte die Schweiz schrittweise an jene Agenda herangeführt worden sein, die offiziell nicht „verbindlich“ ist, in der Praxis aber koordinierend wirkt. Wer weiss?
Sollte dies zutreffen, würde sich auch in diesem Punkt bestätigen, was sich wie ein roter Faden durch die gegenwärtige sicherheitspolitische Ausrichtung zieht: Die Schweiz folgt strategischen Zielsetzungen, an deren Zustandekommen sie nicht beteiligt war, übernimmt aber deren Umsetzung, still, schrittweise und ohne öffentliche Debatte.
Plandemie als Resilienztest?
Besonders brisant erscheint in diesem Zusammenhang die Rolle des dem Resilience Committee unterstellten Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre (EADRCC). Dieses Zentrum, 1998 gegründet und bei der NATO in Brüssel angesiedelt, ist zuständig für die Koordination internationaler Katastrophenhilfe im euro-atlantischen Raum, darunter Naturkatastrophen, CBRN-Zwischenfälle (chemisch, biologisch, radiologisch, nuklear), terroristische Anschläge und, wie explizit vermerkt, auch Gesundheitskrisen.
Es wäre daher nicht abwegig zu vermuten, dass das EADRCC auch bei der Bewältigung der Covid-19-Pandemie, oder vielmehr der global orchestrierten Reaktion darauf, eine koordinierende Rolle gespielt haben könnte. Das Zentrum organisiert regelmässig Seminare, Grossübungen und Lageanalysen mit NATO-Mitgliedern und Partnerstaaten, darunter auch der Schweiz. Sollte das EADRCC während der „Plandemie“ operative Impulse gegeben oder als logistische Drehscheibe fungiert haben, wäre das ein Hinweis darauf, dass die Pandemie nicht nur gesundheitspolitisch, sondern auch als sicherheitspolitisches Szenario behandelt wurde, möglicherweise auch als Stresstest für gesellschaftliche Resilienz.
Ein solches Szenario würde erklären, warum in vielen westlichen Staaten die Reaktion auf Covid-19 frappierend synchron ablief, inklusive Lockdowns, Kommunikationsstrategien und zentraler Steuerung über Notrecht. Wenn dabei tatsächlich Strukturen wie das EADRCC im Hintergrund mitgewirkt hätten, wäre das ein weiteres Indiz dafür, dass der Übergang von ziviler Krisenreaktion zu militärstrategischer Governance bereits vollzogen wurde. Und zwar geräuschlos, ohne parlamentarische Kontrolle, dafür aber mit globaler Wirkung.
Neutral auf dem Papier,
transatlantisch im Maschinenraum
Wer glaubt, die Schweiz sei bloss stille Beobachterin, täuscht sich gewaltig. Die Phase des Zögerns ist vorbei. Was sich früher in Randbereichen abspielte, gemeinsame Übungen, technische Standards, gelegentliche Koordination, ist heute in die DNA der Schweizer Sicherheitsarchitektur eingeschrieben. Die NATO hat längst jene subtilen Hebel perfektioniert, mit denen sich Staaten steuern lassen, ohne dass jemand offiziell etwas unterschreibt: Soft Power, normierte Begriffe, und sogenannte „Partnerschaftsdokumente“, deren Tragweite bewusst vage bleibt, damit niemand aufschreit.
Resilienz ist das neue Passwort in diesen Kreisen. Ein strategischer Code, unter dem praktisch jede politische Handlung militärisch legitimiert werden kann. Was früher zivil war, gilt heute als verteidigungsrelevant: Energiepolitik, Gesundheitssysteme, Kommunikationsstrukturen, Migration, Medien, alles potenzielle Schlachtfelder. Alles sicherheitsrelevant. Und damit, in NATO-Sprech, zur Chefsache erklärt.
Das eigentlich Erschreckende: Niemand hat je darüber abgestimmt. Niemand im Parlament hat je verbindlich beschlossen, dass sich die Schweiz an einer militärischen Agenda orientieren soll, die tief in innenpolitische Belange eingreift. Es geschieht einfach. In stiller Koordination. Und mit einer Geschwindigkeit, die jeden demokratischen Reflex unterläuft.
Denn wenn einmal definiert ist, was ein Risiko ist, und wenn diese Definition nicht mehr von gewählten Volksvertretern, sondern von internationalen Militärgremien vorgegeben wird, dann kippt das Verhältnis zwischen Regierten und Regierenden. Dann wird Sicherheit zur übergeordneten Wahrheit. Und alles andere, Grundrechte, Transparenz, Selbstbestimmung, zur Verhandlungsmasse.
Wir sind nicht mehr „nicht weit entfernt“ von einer NATO-gesteuerten Zivilgesellschaft. Wir sind mittendrin. Nur dass es keiner merkt. Weil keine Panzer rollen, keine Truppen marschieren, keine Erklärungen abgegeben werden. Der Umbau geschieht leise. Planvoll. Und mit der schleichenden Eleganz einer Agenda, die nicht auf Zustimmung, sondern auf Systemwirkung setzt.
Bleibt eigentlich keine Frage mehr offen. Denn was einst als Partnerschaft begann, ist heute längst funktionale Integration. Ohne Beitritt, aber mit maximaler Wirkung. Die Schweiz erfüllt NATO-Standards, denkt in NATO-Kategorien, plant in NATO-Szenarien. Und nennt das weiterhin Neutralität.
Faktisch ist die Schweiz heute ein NATO-Aussenposten mit Alpenpanorama, aber ohne Mitbestimmung. Ein Land, das sich freiwillig in eine strategische Abhängigkeit begibt, deren Regeln anderswo geschrieben werden. Und das grösste Sicherheitsrisiko? Ist längst nicht mehr Russland, sondern der Verlust der eigenen Souveränität.


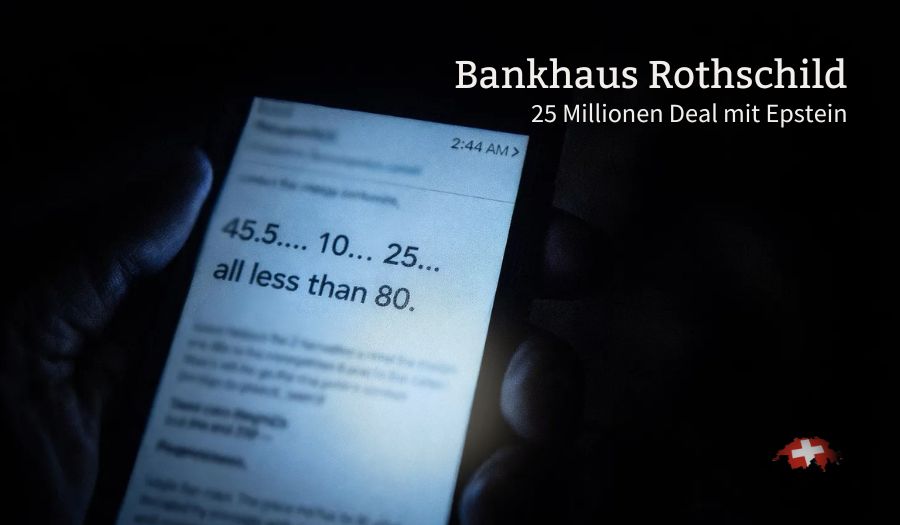







0 Comments