UBS auf Wanderschaft:
Fluch oder Segen für die Schweiz?
Die Schlagzeilen klingen dramatisch: UBS prüft den Abzug
Die UBS ist für viele ein Nationalheiligtum, fast wie das Tell-Denkmal in Altdorf. Entsprechend gross ist die Empörung, wenn die Bank droht, die Schweiz zu verlassen.
Während sich Politik und Medien in Alarmstimmung versetzen, möchten wir hier einen anderen Gedanken ins Spiel bringen. Noch ist selbständiges Denken in der Schweiz nicht verboten. Könnte es sein, dass ein Abzug der UBS sogar positive wirtschaftliche Effekte hätte? Für Herrn und Frau Schweizer, für die Menschen, die jeden Tag arbeiten und sparen und trotzdem niemals auch nur Millionär, geschweige denn Milliardär werden?
Bevor wir loslegen: Uns ist bewusst, dass Themen wie Eigenkapital, Geldschöpfung und Bankenregulierung hochkomplex sind. Man könnte sie mit seitenlangen volkswirtschaftlichen Modellen und Theorien belegen, aber wer will das schon lesen? Deshalb erklären wir hier bewusst vereinfacht, damit der rote Faden für alle sichtbar wird. Denn eines ist erstaunlich: Bis heute wird die Geldschöpfung in vielen VWL-Studiengängen praktisch ausgeklammert. Studenten lernen Modelle, die ohne diesen Kernmechanismus auskommen, und wundern sich dann, dass die ökonomische Realität so oft nicht mit der Theorie übereinstimmt. Es scheint fast so, als solle die breite Öffentlichkeit gar nicht so genau wissen, wie das System tatsächlich funktioniert.
Nun also die nächste Drohung: Die UBS denkt laut über den Abzug ihres Hauptsitzes nach und liebäugelt mit den USA.
Doch vielleicht lohnt sich ein kühler Blick: Für die Schweiz könnte ein solcher Schritt durchaus auch positive Seiten haben. Denn der ganze Zirkus rund um Eigenkapital, Geldschöpfung und ‚Too big to fail‘ ist am Ende nichts anderes als ein gigantisches Kartenhaus.
Was heisst Eigenkapital überhaupt?
Stellen wir uns eine ganz einfache Rechnung vor: Die Bank hat 19 Franken Eigenkapital. Mit diesen 19 darf sie nach geltenden Regeln in der Schweiz 100 Franken an Krediten ausgeben. Woher kommen die restlichen 81? Sie werden einfach neu geschaffen per Mausklick, aus dem Nichts. Dieses System nennt man „Fractional Banking“ (Mindestreservesystem). Klingt technisch und harmlos, ist aber im Kern nichts anderes als die Erlaubnis für Banken, Geld zu drucken. Und zwar nicht für alle, sondern nur für sich selbst.
Ein Beispiel aus dem Alltag: Angenommen, Sie gehen zu Ihrer Bank und nehmen einen Kredit von 100 Franken auf. Die Bank muss dafür nur 19 Franken hinterlegen, die sie irgendwo als Sicherheit gebucht hat. Die übrigen 81 Franken tippt sie in ihr Computersystem ein – schwupps, Ihr Kredit ist entstanden. Sie sehen auf Ihrem Konto die 100 Franken, aber tatsächlich hat die Bank nur einen Bruchteil davon real unterlegt. Für Sie bedeutet das: Sie zahlen Zinsen auf Geld, das nie wirklich existiert hat.
Das Märchen vom sicheren System
Die Bankenwelt verkauft uns das gerne als ausgeklügeltes, sicheres System. Man spricht von „Reserven“, „Eigenmitteln“ oder „Sicherheitsmargen“. Aber in Wahrheit ist es ein Kartenhaus: Alles funktioniert nur so lange, wie die Schuldner brav zahlen und niemand zu viele Kredite gleichzeitig zurückfordert. Sobald ein „Margin Call“ kommt, also die Aufforderung, plötzlich echtes Geld bereitzustellen, bricht das System zusammen. Denn die 81 Franken aus dem Nichts lassen sich nicht einfach herbeizaubern, wenn die Lage ernst wird.
Genau hier setzt der Mythos „Too big to fail“ an:
Wenn eine Grossbank wie die UBS fällt, reissen ihre Luftkredite das ganze System mit. Deshalb wagt sich die Politik kaum an echte Reformen, sondern tanzt nach der Pfeife der Banken. Die Drohung lautet immer: „Wenn wir fallen, fallt ihr alle mit.“
Nebenbemerkung: Dabei wäre es im Grunde einfach: Banken und ihre Aktionäre müssten die eingegangenen Risiken selbst tragen, wie jedes andere Unternehmen auch. Stattdessen gilt das Prinzip „Gewinne privatisieren, Verluste sozialisieren“. Doch an dieses Fundament des Problems wagt sich die Politik nicht heran. Nicht, weil es zu komplex wäre, sondern weil die Profiteure des Systems, die Finanzoligarchie, es nicht wollen. Und solange die meisten Menschen das System nicht durchschauen, bleibt der Druck von unten aus.
Nach der Finanzkrise: Versprechen ohne Wirkung
2008 erschütterte die Finanzkrise die Welt. Auch die Schweiz erlebte, wie nah sie am Abgrund stand. Gross versprochen wurde damals: Die Banken müssten mehr Eigenkapital halten, Risiken würden eingedämmt. Doch wie so oft blieb es bei halbherzigen Reformen. Die Eigenkapitalquote wurde zwar erhöht, aber das Grundproblem, das Recht der Banken, Geld aus dem Nichts zu schaffen, blieb unberührt.
UBS blieb systemrelevant und damit ein permanentes Drohpotenzial. Denn die Bank weiss: Fällt sie, fällt das ganze Land mit. Dieses Machtmittel macht jede Regierung gefügig. Strengere Regeln? Steuerlast? Standortpolitik? Alles wird zur Verhandlungssache, weil der Kollaps keine Option ist. So wurde „Too big to fail“ zur Normalität und die Schweiz blieb im Würgegriff. Und nun? Statt Lehren aus der Vergangenheit zu ziehen, geht das Spiel weiter.
Warum UBS droht auszuwandern
Heute ist der Druck plötzlich grösser: Die Schweiz will die Schrauben endlich anziehen und fordert 19 % Eigenkapital. Für jeden Kredit über 100 Franken müssen 19 Franken Substanz vorhanden sein. In den USA dagegen reichen 8 %. Das klingt nach einer kleinen Differenz, ist aber ein massiver Unterschied. Rechnen wir: Für 100 Milliarden an Krediten braucht UBS in den USA nur 8 Milliarden Eigenkapital. In der Schweiz wären es 19 Milliarden. Das sind 11 Milliarden weniger, die sie aufbringen müsste, bares Geld, das direkt in mehr Kredite und höhere Gewinne übersetzt werden kann.
Die Botschaft der UBS an die Schweizer Politik ist klar: „Lasst uns weitermachen wie bisher, sonst ziehen wir dorthin, wo wir weniger Fesseln haben.“ Standortpolitik? Von wegen. Es ist der offene Wunsch, weiter nach Belieben Geld zu schöpfen und Risiken in die Welt hinauszupumpen.
Das „Zypern-Szenario“ für die Schweiz
Man sollte demnach fragen dürfen: Was wäre schlimmer: Wenn UBS bleibt oder wenn sie geht? Die Angst der Politiker ist klar: Sollte UBS in der Schweiz bleiben und eines Tages zusammenbrechen, wäre der Schaden gigantisch. Ein Blick nach Zypern 2013 zeigt, was passieren kann: Bankpleite, Guthaben eingefroren, Bürger über Nacht enteignet.
Ein „Bail-in“ nannten sie das. Schönes Wort für Raubzug.
Doch was heisst das konkret? Ein Bail-in läuft nach einer klaren Reihenfolge: Zuerst werden die Aktionäre bedient, dann die Gläubiger. Ganz am Ende aber sind es die einfachen Kunden, deren Konten herangezogen werden. Wer also glaubt, sein Geld sei bei einer Grossbank sicher, sollte wissen: Im Crashfall sind es genau diese Guthaben, die als letzte Reserve dienen. Mit anderen Worten: Die Aktionäre retten sich zuerst, während der normale Schweizer mit grosser Wahrscheinlichkeit leer ausgeht.
Zur Erinnerung: In Zypern gab es 2013 den grossen „Haircut“. Alle Bankkonten über 100‘000 Euro wurden zwangsweise gekürzt, kleinere Guthaben wochenlang eingefroren. Bargeldabhebungen wurden rationiert, Überweisungen streng kontrolliert. Renten und Löhne flossen nur noch verzögert oder teilweise, viele Familien standen plötzlich ohne Zugriff auf ihr Erspartes da. Die Folge war eine tiefe Wirtschaftskrise, Arbeitslosigkeit und ein dramatischer Einbruch der Immobilienwerte. Ganze Existenzen wurden vernichtet.
Am Ende wurden nicht die Bürger gerettet, sondern die Banken. IWF, EZB und EU-Kommission, die berüchtigte „Troika“, stellten Milliarden bereit, um das Finanzsystem zu stabilisieren. Die Bevölkerung dagegen zahlte die Zeche und brauchte fast ein Jahrzehnt, um sich von diesem Schock zu erholen. Genau dieses Szenario droht, wenn eine systemrelevante Grossbank wie UBS ins Wanken gerät.
Der trügerische Trost der Einlagensicherung
Manche wiegen sich in Sicherheit und verweisen auf die Einlagensicherung von 100’000 Franken. Doch die gilt pro Kunde, nicht pro Konto und sie ist auf insgesamt 7,9 Milliarden Franken für alle Banken begrenzt. Wenn eine Grossbank wie die UBS kippt, reicht das nicht einmal für die Kaffeekasse. Wer also glaubt, er sei mit dem sogenannten Einlegerschutz wirklich abgesichert, sollte sich das Kleingedruckte genauer anschauen.
Wichtig für die Reichen, irrelevant für den Alltag
Für die Schweiz wäre ein UBS-Crash fatal. Das Land hängt am Tropf seiner Banken. Doch wenn die UBS ins Ausland abwandert? Dann exportiert man die systemische Zeitbombe. Das Risiko würde auf andere Schultern verlagert, während die Schweiz sich ein Stück weit Luft verschafft. Für die Bürger hierzulande wäre das ökonomisch sogar ein Vorteil: Die Bank würde ihre Risiken nicht mehr auf die Schweizer Volkswirtschaft abwälzen.
Und Hand aufs Herz: Kein normaler Schweizer braucht eine UBS. Für Hypotheken, Geschäftskredite oder Alltagskonten sind Kantonalbanken, Raiffeisen und Regionalbanken da. Zumal die UBS viele Kunden gar nicht mehr will. Hören Sie sich im Bekanntenkreis um: Zahlreiche ehemalige Credit-Suisse-Kunden berichten, dass sie schlicht nicht mehr erwünscht sind. Der Fokus liegt längst nur noch auf grossen Vermögen und internationalen Mandaten.
Banken brauchen keine Fabriken
Man muss sich eines klarmachen: Banken brauchen im Grunde keine Produktionsmittel ausser Computern und ein paar Menschen. Jedenfalls keine Fabriken, keine Rohstoffe, keine Lagerhallen. Sie produzieren nichts Greifbares. Sie machen Gewinne aus dem Nichts, grob gesagt. Und da sie nur vergleichsweise niedrige Dividenden ausschütten, steckt sich das Management den grössten Teil des Kuchens selber ein.
Hat sich schon einmal jemand gefragt, warum Banker so viel verdienen? Nicht, weil sie Maschinen bauen, Autos produzieren oder Lebensmittel herstellen. Sondern weil sie mit Zahlen jonglieren, die sie selbst in die Welt gesetzt haben. Das Finanzcasino hat mit der Realwirtschaft längst nichts mehr zu tun. Es hat sich abgekoppelt. Während Bauern, Handwerker oder Ingenieure Werte schaffen, drehen Banker riesige Summen im Kreis. Allein der tägliche Devisenhandel ist um ein Vielfaches grösser als die gesamte weltweite Wirtschaftsleistung; Schätzungen sprechen von 200- bis 300-mal. Je grösser die Buchungsposten, desto grösser die Boni. Das Einkommen der Banker misst sich nicht an realer Wertschöpfung, sondern an der Grösse der Risiken, die sie eingehen. Ein perfides System, das genau deshalb so schwer zu kontrollieren ist: Es produziert keine echten Werte, sondern nur Ansprüche und kassiert dafür realen Reichtum.
Braucht die Schweiz wirklich eine internationale Grossbank?
Politiker und Medien wiederholen gebetsmühlenartig: „Die Schweiz braucht eine internationale Grossbank, um im Konzert der Grossen mitzuspielen.“ Doch das ist ein Märchen, das bei genauerem Hinsehen zerbricht. Wohlstand entsteht nicht durch eine globale Riesenbank, sondern durch funktionierende lokale Banken, die den Mittelstand finanzieren. Richard Werner hat es auf den Punkt gebracht (gerne Interview mit Tucker Carlson ansehen): Wirtschaftswachstum und Stabilität hängen davon ab, dass Kredite dort ankommen, wo sie produktiv eingesetzt werden bei Handwerkern, Bauern, kleinen und mittleren Betrieben. Genau das leisten wie oben bereits erwähnt Raiffeisenbanken, Kantonalbanken und Sparkassen. Sie sind das Rückgrat der Volkswirtschaft, nicht die UBS.
Schauen wir nach Dänemark, Österreich oder auch in andere europäische Länder. Diese haben keine global dominanten Banken, die auf jeder internationalen Konferenz glänzen. Dennoch existieren funktionierende Volkswirtschaften, die ihre Menschen versorgen mit Jobs, Löhnen und Krediten für die Realwirtschaft. Was sie verbindet: lokale Banken, die mit der heimischen Wirtschaft verwoben sind. Genau dort entsteht echter Wohlstand.
Die UBS dagegen ist auf ganz andere Dinge spezialisiert: Offshore Banking, Vermögensverwaltung, internationale Steuerkonstrukte, Devisenhandel, Fusions- und Übernahmegeschäfte. Das ist das Kerngeschäft. Mit der Finanzierung von KMUs in Luzern, Schwyz oder Appenzell hat das so gut wie nichts zu tun. Kurz:
UBS ist eine globale Geldmaschine, deren Nutzen für den Alltag der Schweizer Bevölkerung verschwindend gering ist, während die Risiken enorm sind.
Was bringt also eine Grossbank wie die UBS dem Land? Sie bringt vor allem systemische Risiken, weil sie im Krisenfall den ganzen Staat in Geiselhaft nimmt. Gewinne landen bei Aktionären und Management, Verluste werden im Zweifel sozialisiert. Für die Bevölkerung ist das ein schlechtes Geschäft. Die Schweiz braucht keine Grossbank für ihren Wohlstand, sie braucht ein stabiles Netz von regionalen Banken, die echte Wertschöpfung finanzieren. Eine Grossbank ist höchstens für das Prestige gut, fürs Schaulaufen auf internationalen Konferenzen. Für die reale Wirtschaft bringt sie wenig.
Fractional Banking = Euphemismus für Wucher
Am Ende bleibt nur die schonungslose Wahrheit: Fractional Banking heisst, Banken dürfen Geld erzeugen, das sie nicht haben. Sie verleihen es, kassieren Zinsen, und wenn’s schiefgeht, darf die Bevölkerung zahlen. Dieses System ist nichts anderes als ein staatlich abgesegnetes Glücksspiel, das bei Verlusten sozialisiert und bei Gewinnen privatisiert wird.
Das aktuelle Bluff-Theater der UBS zeigt nur eines: Strengere Eigenkapitalregeln sind kein Standortnachteil, sondern Überlebensschutz für die Bürger. Wenn UBS meint, sie sei in den USA besser aufgehoben, dann soll sie ziehen. Je schneller, desto besser. Denn solange Banken hierzulande Geld aus dem Nichts erzeugen dürfen, bleibt die Schweiz im Würgegriff des Systems.
Unterm Strich:
Der Abzug der UBS wäre kein nationaler Albtraum, sondern ein Befreiungsschlag. Die Schweiz würde nicht ärmer, sondern sicherer. Denn wer Banken erlaubt, Luftgeld zu erzeugen, lädt das nächste Desaster direkt vor die Haustür ein. Und wenn es kracht, stehen wieder die Steuerzahler da, ausser, die Bombe ist vorher ins Ausland exportiert worden.
Und wer jetzt meint, ein Crash einer Schweizer Grossbank sei reine Schwarzmalerei, dem sei nur ein Name ins Gedächtnis gerufen: Credit Suisse. Eben noch angeblich unverzichtbar, heute Geschichte. Auch die UBS ist nicht unfehlbar, das Casino-Spiel kann eben auch in die Hose gehen. Rein mathematisch führt die Aufblähung der Geldmengen irgendwann zur nächsten Finanzkrise, wenn er nicht vorher mit einem „Notfall“ überdeckt wird: sei es Krieg, Finanzschock oder ein Ausnahmezustand nach Pandemie-Vorbild.
Allenfalls würden ein paar Zürcher Hotspots wie die Kronenhalle, TAO’s oder der Club Baur au Lac etwas an Banker-Frequenz verlieren, aber die Schweizer Wirtschaft sicher nicht. Am Ende bleibt die Frage: Fluch oder Segen? Für die Banker und Aktionäre mag ein Abzug wie ein Fluch wirken – für Herrn und Frau Schweizer könnte er durchaus ein Segen sein.
UBS – ein goldener Kalbskult?
Für manche klingt diese Argumentation wie Blasphemie: Kritik an der UBS – das ist doch, als würde man am Nationalheiligtum rütteln! Aber Hand aufs Herz: Diese Bank ist längst keine schweizerische Institution mehr, sondern ein globales Finanzvehikel. Unter den grössten Aktionären finden sich BlackRock, Vanguard oder Norges Bank – alles andere als eidgenössische Patrioten. Im Verwaltungsrat sitzen internationale Funktionäre, und das eigentliche Geschäft spielt sich in New York, London oder Hongkong ab. Offshore Banking, Vermögensverwaltung für Superreiche und Steueroptimierung sind der Alltag, nicht die Finanzierung von Bäckern und Handwerkern in der Innerschweiz.
Wer also immer noch meint, UBS sei ein Stück Heimat und nationale Identität, sollte die rosarote Brille abnehmen. Die wahre Blasphemie besteht nicht darin, die UBS zu kritisieren, sondern weiterhin so zu tun, als diene sie der Schweiz. In Wahrheit dient sie internationalen Kapitalinteressen und hält die Bürger als Geisel im Spiel mit „Funny Money“.
Wer die UBS in der Schweiz behalten will, muss im Ernstfall bereit sein, mit dem eigenen Vermögen für sie zu zahlen.


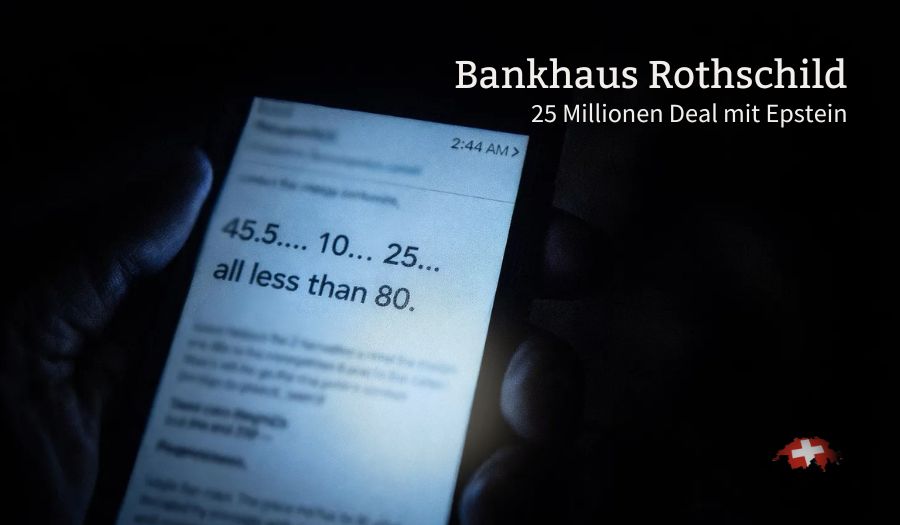







0 Comments