Unfair ID -Agenda 2030
globale Kontrolle und die Schweizer Falle
Agenda 2030 – Das falsche Versprechen
Offiziell heisst es: Die Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 sollen mehr Gerechtigkeit, Inklusion und Teilhabe schaffen. Klingt nach einer hehren Mission. Doch in Wahrheit steckt dahinter ein globales Projekt, das nicht zur Befreiung, sondern zur Versklavung der westlichen Zivilisation führt. Besonders perfide: das Ziel SDG 16.9: „Legal identity for all“ (rechtliche Identität für alle). Was wie ein Menschenrecht klingt, wird in der Praxis zum Zwangssystem: eine digitale Pflichtregistratur, die Menschen in Datenkörper verwandelt und sie nur noch dann an Rechten teilhaben lässt, wenn der Computer „Ja“ sagt.
Internationale Expertinnen wie Prof. Silvia Masiero (Universität Oslo) haben das in ihrem Buch Unfair ID klar aufgezeigt: Digitale Identitätssysteme sind keine neutralen Verwaltungsinstrumente, sondern Maschinen der Exklusion und Kontrolle. Von Indien bis Italien, von Nigeria bis Jordanien zeigt sich: Wer nicht ins Schema passt, wird ausgeschlossen, sei es durch fehlerhafte Daten, fehlende biometrische Merkmale oder schlicht, weil die Maschine die Vielfalt menschlicher Identität nicht abbilden kann.
Und genau hier liegt der entscheidende Punkt:
Die Schweizer E-ID ist kein harmloses Digitalprojekt. Sie ist die direkte Umsetzung dieser globalen Agenda, ein lokaler Ableger der weltweiten Kontrollarchitektur.
Warum die Schweizer E-ID mehr Risiko als Fortschritt ist
Die E-ID wird uns in der Schweiz als praktisches, modernes Werkzeug verkauft: ein Schlüssel zu Ämtern, Banken, Versicherungen, vielleicht bald auch zum Reisen. Freiwillig, sicher, komfortabel. So lautet das offizielle Märchen. Doch wer genauer hinschaut, erkennt: Hier wird ein Experiment gestartet, das international längst als gefährlich entlarvt ist.
Globale Warnungen und die Schweiz ignoriert sie
Ein Bericht des Center for Human Rights and Global Justice (NYU) aus dem Jahr 2022 bringt es auf den Punkt: Digitale Identitätssysteme sind nicht neutrale Verwaltungsinstrumente, sondern Maschinen der Exklusion und Kontrolle. Sie verwandeln Menschen in Datenkörper, die nur dann Zugang zu Rechten haben, wenn die Maschine sie akzeptiert. Indien hat es mit Aadhaar vorgemacht, mit verheerenden Folgen: Millionen wurden von Sozialleistungen ausgeschlossen, weil ein Fingerabdruck nicht lesbar war oder ein Datensatz fehlerhaft. Ergebnis: Hunger, Armut, Entrechtung.
„Digitale Identität ist kein Fortschritt, sie ist ein Filter. Und Filter schliessen aus.“
SDG 16.9 – Das Feigenblatt
Die Agenda 2030 verkauft digitale ID als Erfüllung des Nachhaltigkeitsziels SDG 16.9 („Legal identity for all“). Klingt gut, oder? Doch der Trick ist billig: Ein Menschenrecht (Recht auf Identität) wird in ein technisches Pflichtregister verwandelt. Inklusion wird zur Lüge: wer nicht ins Raster passt, wird ausgeschlossen. Die schönen Worte von „Nachhaltigkeit“ und „Inklusion“ sind nichts anderes als Marketing für eine globale Kontrollarchitektur.
Die Schweiz hat sich offiziell verpflichtet, die Agenda 2030 umzusetzen und damit auch SDG 16.9. Doch anstatt über die Risiken dieser Digitalisierungsagenda zu diskutieren, wird hierzulande kritiklos übernommen, was internationale Institutionen wie die Weltbank und ID4D (Identification for Development) vorgeben. Der Bundesrat verweist regelmässig auf die Nachhaltigkeitsziele, um innenpolitisch Zustimmung zu gewinnen. Aber was bedeutet das konkret? Es bedeutet, dass ein globales Projekt zur Vereinheitlichung von Identitätssystemen schrittweise auch in der Schweiz Realität wird.
Hinter dem Versprechen der „Legal identity for all“ steckt ein Mechanismus, der Staaten in die Pflicht nimmt, digitale Identitätssysteme einzuführen, egal, ob die Bevölkerung dafür bereit ist oder nicht. Statt echte Rechtsstaatlichkeit zu stärken, werden technische Standards gesetzt, die Bürger in Datenform pressen. Der vermeintliche Fortschritt besteht darin, dass der Mensch auf Maschinenlesbarkeit reduziert wird. Wer nicht kompatibel ist, bleibt unsichtbar. Wer sich verweigert, wird Schritt für Schritt aus dem öffentlichen Leben gedrängt.
So entsteht ein Paradox: Was als globales Inklusionsziel verkauft wird, wird zur Exklusionspraxis vor Ort. In Indien hiess es: kein Aadhaar, kein Zugang zu Nahrung. In Italien bedeutet es: keine digitale ID, keine Teilnahme am gesellschaftlichen Alltag. In der Schweiz könnte es bald heissen: ohne E-ID kein Zugriff auf Behördendienste, kein Abschluss wichtiger Verträge, kein funktionierendes digitales Leben. Und das alles im Namen der Agenda 2030, die offiziell für Menschenwürde, Teilhabe und Gerechtigkeit steht.
Infobox: Italien – Digitale Identität als stille Pflicht
Die „Carta d’Identità Elettronica (CIE)“
- Fälschungssicherer Ausweis mit Chip und Biometriedaten (Foto + Fingerabdrücke).
- Enthält alle zentralen Angaben: Name, Geburtsdatum, Wohnort, Geschlecht (nur männlich/weiblich).
- Offiziell nicht verpflichtend für italienische Staatsbürger, doch sie ist die am weitesten akzeptierte Form der Identifikation im Alltag.
Warum faktische Pflicht?
- Für Ausländer ist sie praktisch unverzichtbar: ohne digitale ID keine Aufenthaltsgenehmigung, kein Arbeitsvertrag, kein Bankkonto.
- Viele Behördenportale und private Anbieter akzeptieren nur noch die CIE oder die parallel eingeführte „SPID“ (Sistema Pubblico di Identità Digitale).
- Wer keine digitale ID hat, steht im Alltag schnell vor verschlossenen Türen.
Die Risiken:
- Digitale Abhängigkeit: Behörden haben jederzeit Zugriff auf persönliche Daten; ein Ausfall oder ein „Mismatch“ bedeutet Stillstand.
- Sozialer Ausschluss: Ohne gültige digitale ID droht faktisch Unsichtbarkeit im öffentlichen Leben von der Arbeitssuche bis zum Mietvertrag.
Italien zeigt: Auch in der Schweiz würde die „freiwillige“ digitale Identität zur stillen Pflicht. Mit allen Konsequenzen von Überwachung bis Ausschluss.
Was bedeutet es noch für die Schweiz?
Die Schweizer E-ID wird offiziell als „freiwillig“ bezeichnet. Doch wie in Italien, Indien oder Nigeria wird sie schnell zur faktischen Pflicht: Wer keine E-ID hat, wird zum Bürger zweiter Klasse. Zugang zu Behördenportalen? Verwehrt. Anmeldung bei Banken oder Krankenkassen? Blockiert. Digitale Identität ist der neue Passierschein ins Alltagsleben – und wer nicht mitmacht, steht draussen.
Die grössten Risiken:
- Technische Ausschlüsse: Ältere Menschen, Menschen mit beschädigten Fingerabdrücken oder ohne Smartphone.
- Rechtsstaatliche Risiken: Bürgerrechte hängen nicht mehr an Gesetzen, sondern an Algorithmen.
Wenn der Computer Nein sagt, dann gibt es kein Menschenrecht auf Ja.
Die Illusion der Sicherheit
Politiker und Tech-Konzerne versprechen Sicherheit. Tatsächlich bedeutet die E-ID: Zentrale Datenbanken, biometrische Abhängigkeit, Angriffsflächen für Hacker und Machtkonzentration bei privaten Anbietern. Was als Fortschritt verkauft wird, ist in Wahrheit ein trojanisches Pferd: gebaut für Überwachung, Kommerzialisierung und Disziplinierung.
Agenda 2030 – das wahre Endspiel
Unser Fazit: Wer heute „Ja“ zur E-ID sagt, stimmt nicht für Bequemlichkeit, sondern für ein System der Ausgrenzung, Kontrolle und Unsicherheit. Internationale Experten wie Prof. Silvia Masiero warnen längst vor der „Unfair ID“. Warum also soll die Schweiz sehenden Auges in die gleiche Falle tappen?
Sagen wir gemeinsam: NEIN zur E-ID!
Denn wer zur E-ID Ja sagt, sagt am Ende auch Ja zur Agenda 2030 als Kontrollprogramm. Die vermeintlichen Nachhaltigkeitsziele entpuppen sich als Fahrplan für digitale Knebelverträge: Inklusion als Vorwand, Kontrolle als Realität. Genau deshalb braucht es Widerstand. Nicht nur gegen die Schweizer E-ID, sondern gegen das ganze Projekt einer globalen Identitätsinfrastruktur, das uns Schritt für Schritt entrechten soll.


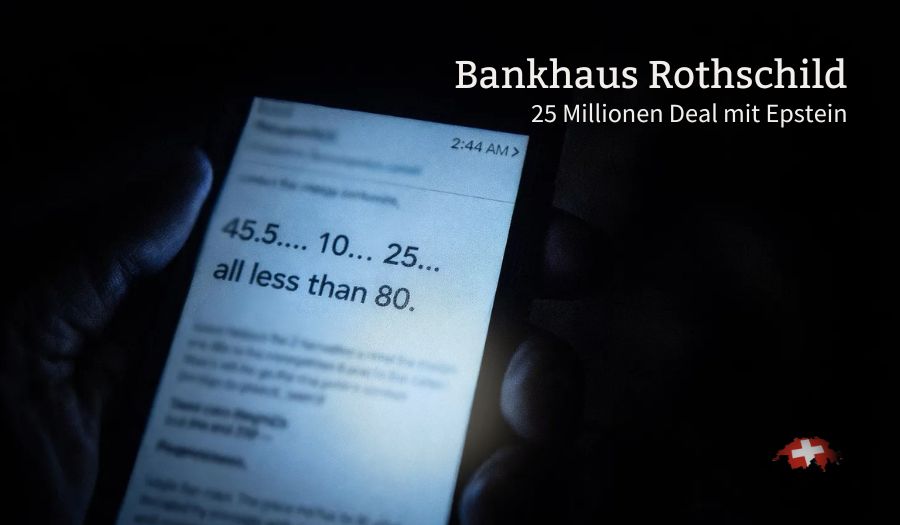







0 Comments