Vom Bürger zum Sicherheitsrisiko
Wie die Schweiz Proteste zur Bedrohung erklärt
WIR staunten nicht schlecht, als uns kürzlich ein deutscher “Aktivist“ erzählte, er wolle Deutschland verlassen, aber ganz sicher nicht in die Schweiz ziehen. Sein Grund: „Weil hier die Überwachung um ein Vielfaches schlimmer ist als in Deutschland.“ Das sass. Und deshalb haben wir genauer hingeschaut.
Die schleichende Verschiebung: 2020 bis 2025
Das Muster ist immer dasselbe: Protest wird nicht frontal verboten, sondern schrittweise umgedeutet: von legitimer Meinungsäusserung zu potenzieller Bedrohung. Das klingt sauber, ist aber ein Werkzeug zur Kriminalisierung von Opposition, ohne dass man das hässliche Wort „Repression“ benutzen muss.
Hier ist ein Auszug aus dem jüngsten Lagebericht des Nachrichtendienstes des Bundes (NDB), und er macht deutlich, wie der Begriff der „hybriden Bedrohung“ genutzt wird, um Proteste und politische Bewegungen in ein sicherheitspolitisches Raster zu zwängen:
Auszug aus „Sicherheit Schweiz 2024“ – Hybride Bedrohung (NDB-Lagebericht 2024)
„Mit hybriden Bedrohungen versuchen staatliche oder nichtstaatliche Akteure, mit verschiedenen diplomatischen, wirtschaftlichen, technologischen oder militärischen Massnahmen Schwachstellen in einem Land auszunutzen.“ (Quelle: NDB-Lagebericht 2024.
Hier wird Protest, wenn er politisch unbequem ist, in den Rahmen solcher „hybriden Eingriffe“ gedrängt, eine Begrifflichkeit, die weit über klassischen Terrorismus hinausgeht und Raum für ein breites Interpretationsspektrum schafft.
2020 – Corona als Startpunkt
Die Pandemie war der Augenöffner: Bürger gingen auf die Strasse, um gegen Maskenpflicht, Lockdowns und Einschränkungen zu demonstrieren. Am Anfang waren das ganz normale Menschen: Familien, ältere Leute, Junge, Ärzte, Kleinunternehmer. Es war ein bunter Mix. Was tat der Staat? Anfangs wurde das Ganze noch als legitime Meinungsäusserung dargestellt, schliesslich garantiert die Bundesverfassung die Versammlungsfreiheit. Doch schon nach wenigen Monaten änderte sich der Ton. Plötzlich sprach man von „Radikalisierung“ und „Gefährdung der öffentlichen Ordnung“.
Medien und Behörden begannen, diese Menschen nicht mehr als Teil der demokratischen Debatte darzustellen, sondern als potenzielles Risiko. Damit begann die semantische Verschiebung: Protest = noch erlaubt, aber schon unter Generalverdacht.
2021 – Der NDB rahmt neu
Im offiziellen Lagebericht des Nachrichtendienstes des Bundes (NDB) tauchten die Massnahmengegner erstmals prominent auf. Sie wurden nicht mehr nur als „Besorgte“ oder „Kritiker“ bezeichnet, sondern als „radikalisierte Bewegungen“. Das ist ein Signal: Wer so bezeichnet wird, rutscht automatisch in das Raster, das sonst Extremisten vorbehalten ist. Damit hatte der NDB die Definitionsmacht über Sprache übernommen. Protest wurde nicht mehr als Ausdruck der direkten Demokratie verstanden, sondern als potenzielle Gefahr für die innere Sicherheit. Ein kleiner semantischer Schritt mit enormer politischer Wirkung.
2022 – WHO & WEF im Fokus
Als Bürger begannen, sich gegen WHO-Verträge und das Weltwirtschaftsforum in Davos zu positionieren, war die politische Antwort nicht: „Lasst uns diskutieren.“ Stattdessen wurden diese Stimmen unter die Kategorie „Desinformation“ eingeordnet. Kritische Fragen zu WHO oder WEF verschwanden aus der politischen Debatte und tauchten nur noch als Warnsignal in Sicherheitsdiskursen auf. Begriffe wie „Delegitimierung“ wurden eingeführt: Wer die Politik kritisierte, war nicht mehr einfach ein Bürger, sondern jemand, der angeblich „Institutionen destabilisieren“ wollte. Mit dieser Wortwahl wurde eine Linie gezogen: Kritik = Gefahr, nicht mehr Beitrag zum Diskurs.
Im selben Jahr trat auch das umstrittene PMT-Gesetz (Polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus) in Kraft. Offiziell nur gegen Terroristen gedacht, erlaubt es Hausarrest, Ausreiseverbote oder Kontaktauflagen schon gegen Personen, die nie eine Straftat begangen haben, allein auf Basis eines Verdachts. Damit wurde die juristische Grundlage geschaffen, um kritische Bürger präventiv wie Sicherheitsrisiken zu behandeln. Ein massiver Dammbruch, der perfekt zum neuen Sicherheitsnarrativ passt.
Ab diesem Moment war klar: Es geht nicht mehr darum, Straftaten zu verfolgen, sondern darum, abweichende Bürger schon im Vorfeld in die Schranken zu weisen.
2023 – Der NATO-Sprech sickert ein
Im NDB-Lagebericht 2023 wurde der Begriff „hybride Kriegsführung“ gross eingeführt. Was bedeutet das? Alles und nichts. Cyberangriffe, Fake News, Spionage, aber eben auch innere Unruhe, also Proteste. Dieser Begriff stammt nicht aus der Schweiz, sondern direkt aus dem NATO-Vokabular. Damit war die Tür offen:
Jede Form von abweichendem Verhalten kann, wenn gewünscht, als „Teil eines hybriden Angriffs“ gerahmt werden. Ein Schweizer, der gegen WHO-Verträge demonstriert, steht plötzlich im selben semantischen Raum wie ein russischer Hacker. Absurder geht es kaum, aber genau so funktioniert Begriffsverschiebung.
2024 – Sicherheit Schweiz 2024
Dann kam der nächste Schritt. NDB-Direktor Christian Dussey erklärte öffentlich: „Der NDB ist von einem Nachrichtendienst in Friedenszeiten zu einem Dienst im hybriden Krieg übergegangen.“ (Quelle: Interview mit Christian Dussey, NDB-Direktor, NZZ, April 2024).
Mit einem Satz wurden sämtliche bisherigen Tabus eingerissen. Wenn die Schweiz offiziell im „hybriden Krieg“ ist, dann ist jeder Protest, jede abweichende Stimme, potenziell Teil des Feindes. Anti-WEF-Demonstrationen, Klimaaktionen oder Proteste gegen internationale Verträge werden seither nicht mehr politisch eingeordnet, sondern wie ein Sicherheitsproblem behandelt. Der Polizei-Einsatz ist keine Ausnahme mehr, sondern Standard. Das ist ein Paradigmenwechsel: Politik verschwindet, Sicherheit übernimmt.
2025 – Technische Aufrüstung
Jetzt schlägt die Technik zu. 171 Einsätze von IMSI-Catchern und 12 Trojanern in einem einzigen Jahr. Dazu kommt die Kabelaufklärung, also das massenhafte Mitlesen des Internetverkehrs über Glasfasern. Offiziell heisst es: „Keine Massenüberwachung.“ Doch Recherchen zeigen: Genau das passiert. Alles wird gespeichert, analysiert, gefiltert. Und wozu? Um angeblich Terroristen zu jagen. In Wirklichkeit landet jeder Bürger im Raster, der laut ist, unbequem oder kritisch. Proteste erscheinen nicht mehr als Teil der Demokratie, sondern in Polizeiberichten als „Störung“ oder „Gefahr“. Wer widerspricht, hat schon verloren, weil er im falschen Vokabular auftaucht.
Schweiz – klein, aber fein verdrahtet
Nachrichtendienstgesetz (NDG)
Seit 2017 darf der NDB Dinge, die in Deutschland selbst für den Verfassungsschutz zu heikel sind:
- Kabelaufklärung (also massenhaft Internetverkehr abschnorcheln).
- IMSI-Catcher (Mobilfunk-Überwachung).
- Trojaner einsetzen.
Alles mit einem schönen Drei-Stufen-Genehmigungsmodell (Bundesrat + Gericht + Kontrollgremium), das aber in der Praxis meist durchgewunken wird.
„Präventive Überwachung“: In Deutschland musst du im Normalfall eine konkrete Straftat im Raum haben, bevor’s richtig losgeht. In der Schweiz reicht schon der Verdacht, dass du „relevant für die innere oder äussere Sicherheit“ bist. Damit ist die Tür offen, auch Aktivisten, Dissidenten oder schlicht kritische Bürger ins Visier zu nehmen.
Geografische Lage & internationale Verflechtung
Die Schweiz ist ein Drehkreuz: Banken, UNO-Büros, WHO, WEF, Rotes Kreuz, Diplomaten. Genau deshalb hat der NDB engste Bande zu CIA, BND, DGSE (Direction générale de la Sécurité extérieur) und Co. Die Schweizer Dienste sind klein, aber hochgradig international verdrahtet.
Datenhunger made in Bern
Vorratsdatenspeicherung? In der Schweiz Pflicht: Telekomfirmen müssen alle Verbindungsdaten 6 Monate lang speichern: Telefon, SMS, E-Mail-Metadaten. In Deutschland hat das BVerfG & der EuGH Vorratsdatenspeicherung praktisch zerschossen. In der Schweiz läuft es seelenruhig weiter.
Kultureller Faktor
In Deutschland schreit sofort die halbe Republik „Stasi!“, wenn der Staat übergriffig wird. In der Schweiz herrscht mehr Vertrauen in die Institutionen. Ergebnis: Weniger Widerstand, mehr Akzeptanz, wenn der Staat die Schrauben anzieht.
Konkrete Beispiele für Überwachung in der Schweiz
1. Kabelaufklärung – digitale Massenüberwachung per Gesetz
Seit dem Nachrichtendienstgesetz (NDG) von 2017 ist dem NDB erlaubt, den Internetverkehr über Glasfaserkabel (sogenannte Kabelaufklärung) zu überwachen. Kritiker, insbesondere die Digitale Gesellschaft, werfen dem NDB vor, dass diese Form der Überwachung ohne Anlass und unabhängig vom Verdacht betrieben wird. Betroffen ist somit faktisch ein grosser Teil der Bevölkerung. Eine Recherche der Republik deckte auf, dass trotz anders lautenden Versprechen der Behörden tatsächlich die Kommunikation der Schweizer Bevölkerung mitgeschnitten wird. Die rechtliche Debatte ist auch juristisch anhängig (Bundesverwaltungsgericht), wobei der NDB sich in Teilen ausweichend und ungenau zeigt. (Quelle: Republik, Januar 2024 und hier)
2. IMSI-Catcher – Handy-Ortung und Massenabgleich
Das sind Geräte, die sich als Mobilfunkmast ausgeben, wodurch sich alle Handys im Umkreis einbuchen. Polizei und Nachrichtendienste können so Standortdaten und Identitäten erfassen, ohne dass die Betroffenen es merken. Laut Berichten werden diese Technik von mehreren Kantonen (u.a. Zürich, Baselland, Luzern) eingesetzt, auch ohne ein konkretes Ziel, oft bei Demonstrationen oder Verkehrskontrollen. Laut einem Bericht von 2025 gab es 171 Einsätze von IMSI-Catchern, sowie 12 Einsätze von Trojanern – im Vergleich zu 160 bzw. 9 im Vorjahr.
3. Satellitenabhörsystem „Onyx“
Die Schweiz betreibt seit Jahrzehnten ein Abhörsystem (Onyx), das Satellitenfunkverkehr abhört und systematisch filtert, mit KI-gestützter Analyse wichtiger Schlüsselwörter. Obwohl früher skandalisiert (Big Brother Award 2000/2001), ist das System operativ und zeigt, wie weit die technischen Möglichkeiten reichen.
Das Muster ist klar:
- Vom Protest zur „Radikalisierung“
Am Anfang steht der ganz normale Bürger, der von seinem Grundrecht Gebrauch macht. Er geht auf die Strasse, hält ein Transparent hoch oder organisiert eine Kundgebung. Früher galt das als selbstverständlich in einer Demokratie. Heute reicht schon eine Handvoll kritischer Stimmen, und plötzlich heisst es: „radikalisiert“. Mit diesem Stempel rutschen Bürger in eine Schublade, die bisher Extremisten vorbehalten war. Es ist ein sprachlicher Trick, aber einer mit weitreichenden Folgen. - Von der Radikalisierung zur „hybriden Bedrohung“
Sobald das Etikett „radikalisiert“ klebt, kann der nächste Schritt folgen: die Einordnung als Teil einer „hybriden Bedrohung“. Dieser Begriff ist so schwammig, dass er alles umfasst von Cyberattacken über Propaganda bis hin zu Protestbewegungen. So wird der Übergang geschaffen: Was gestern noch legitimer Widerspruch war, wird heute zum Sicherheitsrisiko erklärt. Der Bürger steht damit nicht mehr im politischen Diskurs, sondern in einem sicherheitspolitischen Raster. - Von der Bedrohung zur Legitimation für Überwachung
Und jetzt schlägt der Staat zu. Wer einmal als „Bedrohung“ gilt, kann problemlos überwacht, ausgeforscht und mit präventiven Massnahmen belegt werden. Kabelaufklärung, IMSI-Catcher, Vorratsdatenspeicherung, PMT-Gesetz. Alles greift hier ineinander. Die Schwelle zwischen demokratischer Meinungsäusserung und sicherheitsstaatlicher Behandlung ist überschritten. Bürger werden nicht mehr gehört, sondern kontrolliert.
So entsteht ein stiller Paradigmenwechsel, den die meisten gar nicht bemerken. Was früher als selbstverständlich galt, dass Menschen demonstrieren, Kritik äussern und ihren Unmut zeigen dürfen, wird heute systematisch in eine Sicherheitslogik gepresst. Es ist eine stille Umkodierung von Sprache und Gesetz. Der Bürger wird nicht frontal zum Feind erklärt, aber Stück für Stück in diese Richtung verschoben. Wer im Raster des Sicherheitsapparats landet, hat politisch schon verloren. Denn ab diesem Moment zählt nicht mehr, was er sagt, sondern nur noch, dass er als Gefahr markiert ist. Und damit ist der Protest politisch tot.
Unser Fazit
Die Schweiz rühmt sich ihrer direkten Demokratie. Doch die Realität sieht anders aus: Bürgerproteste werden Schritt für Schritt in den Diskurs einer Bedrohung verschoben. Der NDB hat sich selbst in den „hybriden Krieg“ erklärt und überwacht längst im grossen Stil. Es geht nicht um Terroristen. Es geht um uns alle. Um jeden Bürger, der wagt, den Mund aufzumachen.
Das Zusammenspiel von PMT-Gesetz und technischer Überwachung ist dabei das perfekte Kontrollinstrument: erst der Verdacht, dann die Überwachung, schliesslich die präventive Massnahme. Alles legal, alles sauber und doch ein massiver Angriff auf Grundrechte.
Wer hätte das gedacht? Ausgerechnet die Schweiz, die sich so gern als Hüterin der Freiheit darstellt, übertrumpft Deutschland inzwischen beim Schnüffeln. Ein Land, das stolz ist auf seine direkte Demokratie, aber im Schatten leise eine Sicherheitsarchitektur baut, die jeden Protest zur Gefahr erklärt. Vielleicht auch deshalb, weil immer weniger Schweizer wirklich an die direkte Demokratie glauben und sie zunehmend als Scheindemokratie empfinden.
Ein kleiner Selbsttest gefällig?
Und wer jetzt meint, unsere Analyse sei übertrieben, der soll doch einfach mal versuchen, einen Gratis-Bluewin-Account (Light Konto) bei der Swisscom komplett löschen zu lassen, inklusive aller gespeicherten Daten. Wir wünschen gutes Gelingen!
Bleibt nur noch zu sagen: Wer jetzt immer noch für die E-ID stimmt, sollte sich fragen, ob er gleich den Wohnungsschlüssel beim NDB abgeben will.
In diesem Zusammenhang empfehlen wir das Interview von Auf1 mit den Hauptangeklagten der Aktionsgruppe „Junge Tat“.



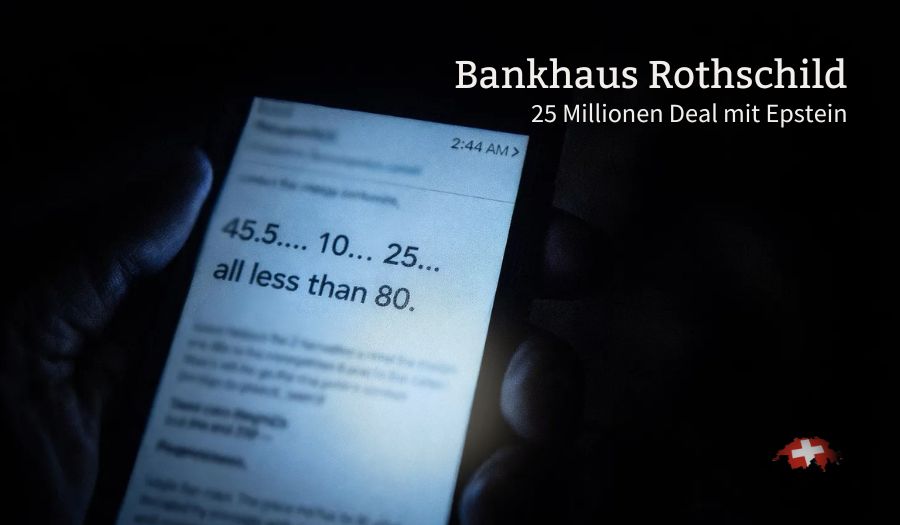







0 Comments