Von Villigen ins Weltall
Wie die Schweiz zum Testlabor der globalen Kontrolltechnik wird
Ein ESA-Zentrum mit orbitaler Tarnung, milliardenschwerer Ambition und riskanter Nähe zu Akteuren wie Palantir, WISeKey & Co. – finanziert vom Bund, kontrolliert von niemandem
Willkommen im Aargauer Deep-State-Dreieck
Villigen, Aargau. Zwischen Kuhweiden, Teilchenbeschleunigern und diskretem Bundeslächeln entsteht ein neues Zentrum der kosmischen Kontrolle: das „European Space Deep-Tech Innovation Centre“ (ESDI) – Was wie ein weiterer Innovationsstandort klingt, ist in Wahrheit ein trojanisches Raumschiff. Elegant geparkt am Paul Scherrer Institut (PSI), funkt es künftig in alle Richtungen – tief ins All, tief in die Datenströme der Schweiz und tief hinein in eine neue Ära der High-Tech-Machtarchitektur.
Der offizielle Anstrich ist schnell gemacht: ESA-Flagge hissen, Start-ups fördern, Nachhaltigkeit trommeln. Doch wer genauer hinsieht, erkennt die tektonischen Verschiebungen hinter der Fassade.
Es geht nicht um ein Labor. Es geht um eine neue Umlaufbahn der Macht – rund um Quantenkontrolle, Orbitalsensorik, Weltraum-Resilienz und militärisch nutzbare Technologien mit globaler Reichweite.
Der Standort ist kein Zufall. Das PSI ist Teil des ETH-Konglomerats – direkt verbunden mit den Forschungsadern der Schweiz. Hier stehen Supercomputer, hier rauschen Neutronen durch Beschleuniger, hier werden Materialien getestet, die sich unter kosmischer Strahlung verhalten wie geplant. Hier wird nicht geforscht. Hier wird vorbereitet.
Das Phi-Lab
Gleichzeitig taucht ein weiteres Instrument auf der Bühne auf: das „Phi-Lab“. Offiziell eine ESA-Innovationseinheit, die Forschung beschleunigen will. Inoffiziell der Ort, an dem aus disruptiven Ideen orbitale Überwachungsarchitekturen werden könnten. Es ist kein Zufall, dass die erste öffentliche Ausschreibung sich mit der Miniaturisierung von Quanten-Sensoren beschäftigt. Sensoren, die Gravitationsveränderungen messen, die Zeit krümmen, Magnetfelder durchdringen – in Schuhkartongrösse. Für den Weltraum. Und natürlich auch für die Erde.
Kontrollzentrum der nächsten Generation
Was hier aufgebaut wird, ist nicht einfach ein Technologietransferzentrum. Es ist ein Kontrollzentrum der nächsten Generation – eine Station im globalen Netzwerk jener Kräfte, die sich „Resilienz“ nennen, aber Steuerung meinen.
Denn während man in Villigen über Innovation spricht, starten in Polen die PFR Ventures ihren €150-Millionen-Fonds für „dual-use“ Technologien. Dort, an der Schnittstelle zu einem kriegsversehrten Nachbarn, wird offen ausgesprochen, was andernorts nur durchblitzt: Künstliche Intelligenz, Cybersecurity, Robotik und Weltraumtechnik dienen nicht nur dem Fortschritt, sondern vor allem der militärischen Verteidigungsfähigkeit. Deep-Tech ist längst Teil des Rüstungsmarktes.
Auch in der Schweiz ist das Netz dichter, als man glauben mag. Palantir, die berüchtigte Datenkrake mit Verbindungen zur CIA, betreibt längst Projekte in Europa, bei der NATO und in der Schweiz – etwa bei Banken, im Gesundheitswesen und vermutlich bald auch im Orbit. WISeKey, die Genfer Cybersecurity-Schmiede mit Weltraumambitionen, betreibt eigene Satelliten und träumt von einer globalen digitalen Identität – verwaltet aus dem All. Und mitten in diesem Bild sitzt die Kudelski Group, jahrzehntelang führend in der Kontrolle von Zugriff und Verschlüsselung – geleitet von André Kudelski, langjähriges Mitglied bei den Bilderbergern. Kein Technologie-Treffen Europas, bei dem er fehlt. Kein Hochsicherheitsprojekt, das ihm fernbliebe.
Und CERN?
Die Nähe zwischen PSI und CERN ist nicht nur geografisch. Beide arbeiten an Strahlung, Teilchen, Zeit. Wer sich fragt, wie sich Quantenforschung und Sensorik verbinden lassen, wird dort fündig – im Nebel aus Forschungsethik und Systemsimulation. Dort, wo Realität auf Berechnung trifft. Dort, wo auch die NATO schon Interesse zeigte.
Und dann ist da noch das Thema Ernährung im Orbit der neuen Ethik: Gibt es im ESDI-Campus bereits die „Planetary Health Diet“ der UNO? Jene futuristische Diät, bei der Erwachsene idealerweise nur noch 2500 Kalorien zu sich nehmen, davon den Grossteil aus Hülsenfrüchten, Nüssen und Soja – und ein Bruchteil tierisch. Alles flexibel, natürlich, aber mit klarer Agenda: Kontrolle beginnt beim Körper, bei der Kalorie, beim CO₂-Fussabdruck auf dem Teller.
Nein, ESDI ist kein Zufall. Es ist ein Zahnrad in einem System, das schneller rotiert als je zuvor. Ein Zentrum, das nicht nur auf das All zielt, sondern auch auf die Erde zurückstrahlt. Es geht um Kontrolle – von Klima, Katastrophen, Kommunikation, Bevölkerung. Und um die Frage, wer Zugang hat. Wer misst. Wer entscheidet.
Muss man für ein solches Zentrum Verträge unterzeichnen? Die Frage stellt sich. 2022 unterschrieb die Schweiz im Rahmen der ESA-Ministerkonferenz gleich mehrere neue Programme. Mit dabei: Raumfahrtplattformen, Orbitalschrottbeseitigung, Kooperationen mit Frankreich und Grossbritannien. Und dann – fast beiläufig – die Einrichtung des ESDI.
Das Institut hat (noch) keine Immunität. Aber es hat Einfluss. Und es hat eine Agenda: Technologiefortschritt um jeden Preis, eingebettet in das europäische Kontrollnarrativ von Resilienz, Nachhaltigkeit und Autonomie.
Und während Brüssel von Souveränität spricht und die UNO von globaler Krisensteuerung, schrauben in Villigen die Ingenieure bereits an der Hardware. An Sensoren, die in Echtzeit jeden Millimeter der Erdkruste überwachen können. An Datenströmen, die sich mit einer Genauigkeit auswerten lassen, die jedem Überwachungsstaat feuchte Träume beschert.
WIR fragen: Wer hat diese Macht bestellt? Wer zieht Nutzen? Und wie lange bleiben solche Technologien ein europäisches „Friedensprojekt“ – bevor sie in den Händen jener landen, die längst wissen, wie man die Welt von oben steuert?
Ein Hoch auf das neue Zeitalter orbitaler Steuerung. Und auf die Schweiz, die jetzt ganz offiziell auf der galaktischen Rasterkarte Platz nimmt, dem galaktischen Kontrollnetz der nächsten Epoche.
Guy Parmelin – Der stille Dirigent des Weltraumkomplexes
Wer trägt die politische Verantwortung für diesen galaktischen Sprung ins Kontrollzeitalter? Nicht etwa Elisabeth Baume-Schneider, wie man angesichts ihrer medialen Präsenz vermuten könnte, sondern der schweigsame Guy Parmelin, SVP-Bundesrat und Vorsteher des Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF).
Während Baume-Schneider PR macht, lässt Parmelin die Milliarden für Supercomputer, Quantentechnologie und ESA-Projekte bewilligen – geräuschlos, aber folgenreich. Das SBFI unter seiner Führung hat 2022 das ESA-Abkommen mitunterzeichnet, die Schweizer Beiträge zugesichert und das ESDI möglich gemacht. Kein Fernsehinterview, kein erklärendes Whitepaper, kein Auftritt in Villigen – nur stille Zustimmung.
Drei Fragen hätten WIR an Bundesrat Parmelin:
- Hat die Schweiz den ESDI-Sitz als diplomatisches „Zückerchen“ erhalten, um sich im Gegenzug EU- und ESA-freundlich zu positionieren – trotz anhaltender Kritik an Brüsseler Machtmechanismen und den Bilateralen III?
- Wie hoch ist der jährliche Beitrag des Bundes an das ESDI – und wer trägt konkret die Kosten für den laufenden Betrieb dieses Zentrums, das offiziell der Förderung des Forschungsstandorts Schweiz dienen soll, aber tief in ESA-Strukturen eingebettet ist?
- Wie stellt die Landesregierung sicher, dass der Schweizer Forschungsstandort nicht zum Spielplatz privatwirtschaftlicher Kontrollarchitekten wie Palantir oder WISeKey verkommt – die längst in sicherheitskritischen Bereichen mitmischen, über internationale Netzwerke schwer kontrollierbar agieren und ohne klare nationale Schutzmechanismen (wie gesetzliche Ausschlussklauseln, Datenhoheit oder Rechenschaftspflichten) das ESDI als Verwertungsplattform für ihre globalen Ambitionen nutzen könnten?
Der Verein WIR fragt weiter. Unermüdlich. Und wenn es sein muss: bis zur letzten Umlaufbahn.
In diesem Sinne: Ein Hoch auf das neue Zeitalter orbitaler Steuerung. Brüssel, Genf, Langley, Cupertino und jetzt auch Villigen – die neuen Koordinaten der globalen Machtachsen.
Und mittendrin: die Schweiz. Toll, dass sie überall dabei ist – mit und ohne Zustimmung des Souveräns. Selbst wenn es am Ende nur dazu dient, den einen oder anderen Bundesrat bei Bedarf in den Orbit zu katapultieren. Das wäre immerhin ein kleiner Return-on-Investment mit Signalwirkung.
Villigen ist näher an Langley, als man denkt.
👨🚀 Die Europäische Weltraumorganisation (ESA) eröffnet einen neuen Standort im Aargau.
Die Europäische Weltraumorganisation (ESA) eröffnet einen neuen Standort im Aargau, Schweiz, um zukunftsorientierte Raumfahrttechnologien zu entwickeln. Schwerpunkte liegen auf Quantenforschung, Datenwissenschaft, Materialforschung, Robotik, künstlicher Intelligenz und nachhaltigen Raumfahrtlösungen.
Der Standort wurde aufgrund der bestehenden Hochtechnologie-Infrastruktur und Expertise im Aargau gewählt. Die ESA kooperiert mit Schweizer Forschungseinrichtungen und Industrieunternehmen, um Deep-Tech-Innovationen (hochkomplexe, wissenschaftsbasierte Technologien) voranzutreiben.
Finanziert wird das Zentrum durch ESA-Mittel und Schweizer Beiträge. Die ESA betont die wissenschaftliche Ausrichtung, während Kritiker die Transparenz der Ziele hinterfragen. Militärische oder geheime Nutzung wurde nicht bestätigt. Die Schweiz ist seit 1976 ESA-Mitglied und engagiert sich in internationalen Weltraumprojekten.
Johann Richard, Leiter des Esdi: „Wir wollen dazu beitragen, Entwicklungen aus dem Schweizer High-Tech- und Deep-Tech-Bereich zum Einsatz zu bringen.“


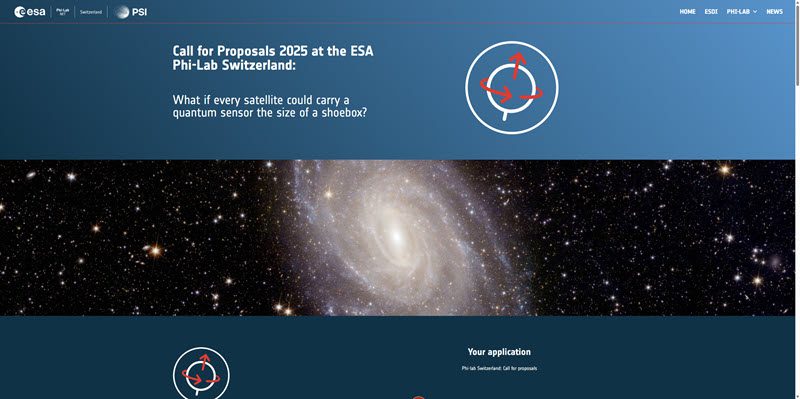
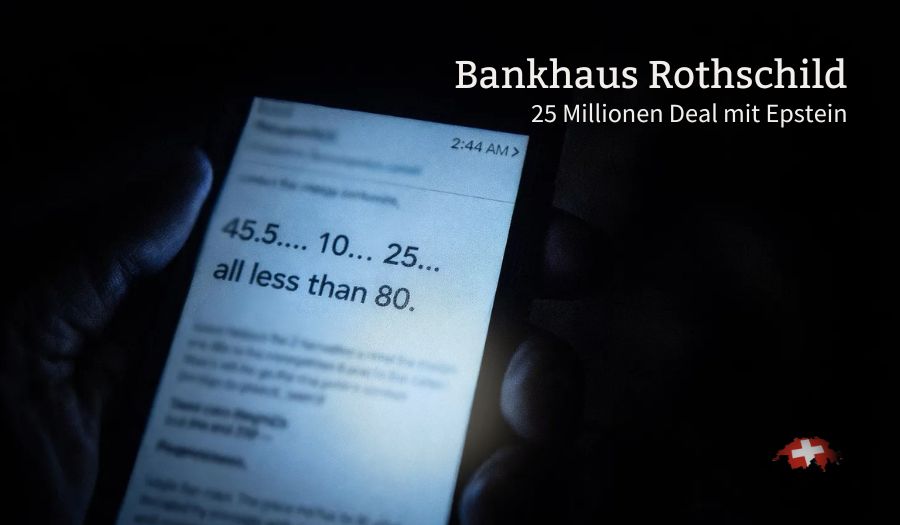







0 Comments