BioHub Schweiz:
WHO-Labor, Virenlager, Kontrollinstrument
Im Dienst der Weltgesundheit – und der nächsten Krise
Die Schweiz als Vorreiterin im Bio-Krisenmanagement?
Was auf den ersten Blick nach humanitärer Gesundheitsdiplomatie klingt, entpuppt sich bei näherem Hinsehen als heikle strategische Infrastruktur mit mächtigem geopolitischem Einschlag: Das Labor Spiez, offiziell Teil des Bundesamts für Bevölkerungsschutz (BABS), ist nicht nur ein nationales Sicherheitslabor für ABC-Bedrohungen, sondern betreibt seit 2021 auch den weltweit ersten WHO BioHub. Dort werden Viren mit Pandemiepotenzial gezüchtet, katalogisiert, tiefgefroren und an qualifizierte Einrichtungen weltweit verteilt – unter Koordination der WHO.
Was passiert im BioHub konkret?
Im Rahmen eines Pilotprojekts hat das Labor Spiez für die WHO SARS-CoV-2-Varianten vermehrt, sequenziert, auf Titer und Sterilität geprüft, gelagert und an Forschungseinrichtungen weitergeleitet. Ziel ist es, eine internationale, multilaterale Plattform für den geregelten Austausch biologischer Materialien mit epidemischem oder pandemischem Potenzial (BMEPP) zu schaffen – weg von intransparenten bilateralen Deals.
WHO-Pakt auf Schweizer Boden: Das einzige offizielle BioHub-Labor
BioHub in Spiez ist weltweit einzigartig. Es gibt bislang nur diesen einen offiziell betriebenen WHO-Hub inklusive Materialflusssystem, Sicherheitsarchitektur und internationalem Vertrauenssiegel. Zwar nehmen Länder wie Thailand am Pilotprojekt teil und liefern Proben – doch die zentrale Infrastruktur, Lagerung, Verteilung und Kontrolle erfolgen ausschliesslich über das Labor Spiez. Andere Länder haben also keinen eigenen WHO-Hub. Die Schweiz bleibt damit exklusiver Betreiber des globalen WHO-Drehkreuzes für biologische Hochrisikomaterialien.
Der Laborleiter spricht Klartext:
„Neu züchten wir auch Viren für die Weltgesundheitsorganisation WHO“,
erklärt Dr. Marc Cadisch, damaliger Leiter des Labors Spiez. Ziel sei es, bei zukünftigen Pandemien „nicht wertvolle Zeit zu verlieren“. Man stelle Forschungsteams weltweit lebende Viren zur Verfügung, damit diese „beispielsweise Impfstoffe entwickeln“ könnten. Cadisch betont: „Das Labor vermehrt die Viren nur und verändert sie nicht.“ Die Erreger würden bei minus 80 Grad Celsius tiefgefroren, „um im Ernstfall zur Verfügung zu stehen“. Auf die Frage nach Sicherheit verweist Cadisch auf den „gescheiterten Spionageangriff im Jahr 2018“, der gezeigt habe, wie sensibel die Arbeit des Labors sei.
Ein Schweizer WHO-Labor mit Zugriff auf globale Erregerdaten?
Die gesammelten Virusdaten (inkl. Genomsequenzen) werden in internationale Datenbanken wie GISAID oder GenBank eingespeist. Das BioHub-System nutzt dabei ein ausgeklügeltes digitales WHO-Portal mit Benutzerprofilen, Metadatenmanagement und Zugriffskontrolle. Die WHO entscheidet, wer auf welche Proben zugreifen darf – unterzeichnete Material Transfer Agreements (SMTA 1/2) regeln die Nutzungsrechte.
Inselspital, Uni Bern und Labor Spiez: eine stille Allianz?
Während das Labor Spiez die BMEPPs für die WHO vermehrt, ist die Uni Bern (MCID, sitem-insel) gleichzeitig daran beteiligt, Proben zu sammeln und zu lagern. Die 2021 gegründete BSL-3-Biobank für „BioPreparedness“ am sitem-insel speichert nicht nur klinische Isolate, sondern erstellt auch synthetische Genome von Hochrisikopathogenen auf Hefebasis (S. cerevisiae). Diese Genome können jederzeit reaktiviert werden – sogenannte „virus rescues“ .
Systematisch gesammelt werden diese Proben unter anderem durch Abstriche bei Migranten und Reisenden im Notfallzentrum des Inselspitals. Es deutet vieles darauf hin, dass hier auf WHO-Empfehlung hin eine Art stille Datenbank mit potenziell ethnisch differenzierbaren Proben entsteht. Würden Patienten das so wissen, könnte das Vertrauen in das Schweizer Gesundheitswesen erschüttert werden.
Denn: Beim Eintritt ins Inselspital unterschreiben Patienten in der Regel den sogenannten General Consent – eine Einwilligungserklärung zur Nutzung ihrer Gesundheitsdaten sowie übriggebliebener biologischer Proben (z. B. Blut, Gewebe) für Forschungszwecke. Diese Einwilligung erlaubt ausdrücklich auch genetische Analysen und die Weitergabe an externe sowie internationale Forschungspartner – unbegrenzt und ohne Rücksprache, solange kein Widerruf erfolgt.
Für spezielle Biobank-Projekte, wie etwa die „Umbrella Biobank Urologie“, existieren darüber hinaus zusätzliche Formulare , die auch aktive Entnahmen und Lagerung von Proben abdecken. Auch hier wird pseudonymisiert, genetisch analysiert und international geteilt. Allerdings unter dem Mantel der „Forschung im öffentlichen Interesse“.
Wer unterschreibt schon eine OP-Einwilligung im Wissen, dass daraus möglicherweise synthetische Bioproben entstehen, deren genetisches Material eines Tages in WHO-Datenbanken landet?
Ein Blick in die Einwilligungserklärung zur „Umbrella Biobank Urologie“ des Inselspitals zeigt, was genau unterschrieben wird – meist beiläufig, unter Zeitdruck, im Klinikalltag:
Die entnommenen Proben (Blut, Urin, Gewebe) dienen nicht dem direkten medizinischen Nutzen der Patienten, sondern werden gezielt für langfristige Forschungsprojekte gesammelt. Die Biobank darf genetische Analysen durchführen, DNA isolieren, Genomdaten aufbereiten und mit klinischen Daten wie Diagnosen und Medikation verknüpfen. Die Nutzung ist international, auch durch Partner in Ländern mit schwächerem Datenschutz.
Patienten erhalten keine Rückmeldung, wenn genetische Risiken oder Auffälligkeiten entdeckt werden. Es sei denn, es besteht eine gesetzliche Verpflichtung. Die Lagerung der Proben ist zeitlich unbegrenzt, auch eine Weitergabe an andere Biobanken ist möglich. Ein Widerruf ist zwar theoretisch erlaubt, muss aber schriftlich eingereicht werden. Bereits genutzte oder verarbeitete Daten werden nicht gelöscht.
Was bedeutet das im Kontext Spiez + WHO?
Diese Biobank könnte das perfekte Rohmaterial für synthetische Genome liefern, wie sie im sitem-insel-Projekt dokumentiert, erzeugt worden sein sollen. Der Datensatz ist hochauflösend, enthält Altersangaben, Gesundheitsverläufe, genetische Informationen und potenziell ethnisch relevante Marker. Die Nutzung erfolgt durch Forschungspartner unter WHO-Koordinierung – nicht durch die Patienten selbst.
Ergänzt wird diese Struktur durch das Insel International Center (IIC), das gezielt zahlungskräftige Patienten aus dem Ausland anspricht und betreut. Das Inselspital hat sich international einen exzellenten Ruf erarbeitet (auch für Transplantationen) und bietet über das IIC einen massgeschneiderten Service für medizinische Betreuung auf Spitzenniveau inklusive Unterstützung bei Visa, Reiseorganisation, Abwicklung von Versicherungsfragen und vollständiger Koordination der Behandlung.
Diese Form lohnender Global-Health-Praxis steht nicht im Widerspruch zur Forschungsarchitektur des Inselspitals. Im Gegenteil: Sie ergänzt die Biobank- und Genomanalyse-Infrastruktur strategisch. Denn auch internationale Patienten unterschreiben in der Regel die gleichen Einwilligungserklärungen wie inländische. So entsteht stillschweigend ein grenzüberschreitender Daten- und Probenpool mit genetischem und klinischem Tiefenprofil. Ein Goldschatz für internationale Forschungsnetzwerke unter WHO-Schirmherrschaft. Einverstanden wird mit einem einzigen Unterschriftsfeld in einem Dokument, das wie eine Routine-Formalität aussieht, deren genetisches Material eines Tages in WHO-Datenbanken landet?
Gain-of-Function: Der Elefant im Raum
Die Kombination aus Biobank, synthetischer Genomik und Zugang zu lebenden Viren schafft die perfekte Voraussetzung für sogenannte Gain-of-Function-Forschung (GoF) – also gezielte Genveränderung, um Erreger infektiöser, übertragbarer oder widerstandsfähiger zu machen. Diese Forschung ist international hoch umstritten und wird in den USA zur Zeit gestoppt, weil sie das Potenzial birgt, versehentlich oder absichtlich neue Pandemien auszulösen. Die Schweiz könnte sich zunehmend als neutraler Boden für eben diese heiklen Experimente anbieten, unter dem Deckmantel internationaler Gesundheitskooperation.
Exkurs: Wenn es „Viren“ – im klassischen Sinne – nicht gäbe
Was machen dann WHO, BioHub, Labor Spiez, Inselspital, mRNA-Forscher und Biobank-Betreiber?
Dann basteln sie nicht an „Viren“ im Sinn eines unsichtbaren Feindes von aussen, sondern an biologischen Konzepten, die:
- krank machen sollen,
- begründet digital kontrollierbar sind,
- patentierbar und monetarisierbar sind,
- technisch herstellbar sind.
Kurz: Sie konstruieren eine biologische Erzählung, an der sich Geld, Macht und Kontrolle organisieren lässt.
Denk in Modulen, nicht in Mikroben: Was „Virus“ genannt wird, ist oft nur ein technischer Begriff für:
- Gensequenzen mit mutmasslicher Wirkung,
- simulierte Modelle mit angeblicher Ansteckung,
- PCR-Signaturen, die als Beweis verkauft werden,
- mRNA-Konstrukte, die auf Zellantworten zielen.
Also: Selbst wenn es „Viren“ nicht im klassischen, infektiösen, krankmachenden Sinn gäbe, wäre das völlig egal, solange die Menschen glauben, dass es sie gibt.
Dann kann man ein ganzes System darum herum aufbauen: Tests, Impfpässe, Quarantäne, WHO-Massnahmen
Exkurs: Vom Human Genome Project zum WHO-BioHub – eine stille Kontinuität
Das Human Genome Project (HGP), das von 1990 bis 2003 lief, war das ambitionierteste Genforschungsprogramm der Menschheitsgeschichte. Ziel war die vollständige Entschlüsselung des menschlichen Genoms als öffentlich zugängliche Ressource für die medizinische Forschung. Was damals als Triumph der Wissenschaft gefeiert wurde, lieferte jedoch nicht nur Erkenntnisse für Therapie und Diagnostik, sondern legte auch das Fundament für heutige Technologien im Bereich synthetischer Biologie, Genomanalyse und personalisierter Medizin.
Die Strukturen, auf denen das BioHub-System der WHO heute basiert – etwa internationale Datenbanken wie GISAID und GenBank oder die Verfahren zur künstlichen Genome-Synthese – sind direkte Erben des HGP. Auch die Vorstellung, genetische Daten global zu erfassen, zu vernetzen und zum „Schutz der Menschheit“ zu nutzen, wurde dort gesellschaftlich verankert.
Was sich aber verändert hat: Während das HGP auf Offenheit, Antidiskriminierung und zivile Nutzung setzte, erleben wir heute eine stillschweigende Verschiebung. Die Schweiz ist mit Spiez, Inselspital und Biobank nicht mehr nur Forschungsstandort, sondern wird zum Biosteuerungspunkt inklusive Zugriffsbeschränkungen, Dual-Use-Potenzial, ethnisch differenzierbarer Probenbank und WHO-gelenkter Verteilung.
Was einst mit dem Ziel begann, den Menschen zu verstehen, droht nun, ihn zu kategorisieren und zu kontrollieren.
Die geopolitische Komponente: Frieden als PR, Kontrolle als Ziel?
Offiziell dient der BioHub dem globalen Gesundheitsschutz. De facto handelt es sich aber um eine sicherheitsrelevante Infrastruktur auf Höchststufe: Zugang zu lebenden Hochrisikopathogenen, zentrale Verteilplattform, WHO-Mandat, tiefgekühlter Vorrat für künftige Krisen. Das klingt weniger nach Frieden, sondern eher nach biologischer Lagerhaltung für globale Machtsicherung. Und: Wer solche Strukturen aufbaut, kann damit nicht nur auf Pandemien reagieren, sondern sie auch auslösen.
Gefahr ethnischer Biotechnologie nicht ausgeschlossen
Wenn in Bern klinische Proben systematisch aus bestimmten Bevölkerungsgruppen entnommen und mit synthetischer Genomik weiterverarbeitet werden, ist auch das Potenzial für genetisch selektive Forschung gegeben. Ethnisch wirksame Biowaffen gelten in sicherheitspolitischen Kreisen nicht als Fantasie, sondern als denkbare technologische Option im militärischen Dual-Use-Bereich. Das weiss man auch im ABC-Kompetenzzentrum Spiez.
Neubau unter der Erde? Was hat das zu bedeuten?
Seit 2023 kursieren Gerüchte, dass das Labor Spiez in unterirdische Schutzbauten verlegt werden soll. Offizielle Begründung: erhöhte Sicherheitsstandards und Schutz vor Sabotage. Inoffiziell drängt sich die Frage auf: Warum muss ein WHO-Biolagerbunker unter die Erde? Was wird dort zukünftig gelagert oder vorbereitet, das nicht mehr an die Oberfläche darf? Die Kombination aus diplomatischer Immunität, BSL-4-Kapazität und unterirdischer Infrastruktur erinnert eher an militärische Kommandozentralen als an Gesundheitslabore.
Die Schweiz im Zentrum eines stillen, biologischen Infrastrukturstaats
Mit dem BioHub im Labor Spiez, der Biobank am Inselspital und der WHO-Kooperation etabliert sich die Schweiz als diskreter globaler Drehscheibenstaat für das sogenannte „Pandemie-Management“. Ein Begriff, der suggeriert, man wolle helfen, aber in Wahrheit Strukturen etabliert, die überhaupt erst die Voraussetzungen schaffen, um gezielt globale Gesundheitsnotstände herbeizuführen. Keine einzige „Pandemie“ der letzten Jahrzehnte war natürlich. Stets spielte der Mensch, gewollt oder fahrlässig, eine Hauptrolle. Und nun scheint ausgerechnet die neutrale Schweiz jene Strukturen aufzubauen, die für das nächste grosse biologische Narrativ bereitstehen könnten.
Denn was hier unter dem Label „Global Health“ läuft, ist in Wahrheit ein komplexes Dreiecksmodell aus Datenmacht, Biotechnologie und geopolitischem Einfluss, bei dem die Schweiz – offiziell neutral – eine Zentralposition einnimmt. Und nein: nicht alle Länder machen das so. Die Schweiz bietet dafür besonders attraktive Bedingungen:
Warum ist es besonders brisant – gerade in der Schweiz?
Neutralität als Tarnkappe
Die Schweiz geniesst international Vertrauen. Sie gilt als unparteiisch, sicher und datenschutzfreundlich. Das macht sie zum idealen Ort für globale Bio-Hubs. Diese Reputation wirkt wie ein moralischer Freifahrtschein.
Stabile Infrastruktur + Know-how
Hochsicherheitslabore (wie Spiez), Universitäten (Uni Bern, ETH), Klinikgruppen (Inselspital) – alles auf kleinstem Raum, gut vernetzt, staatlich koordiniert. Ein globaler Bio-Technologie-Knotenpunkt ohne viel Aufsehen.
WHO-Pakt auf Schweizer Boden
Der WHO-BioHub in Spiez ist einzigartig. Es gibt bislang nur diesen einen offiziell betriebenen WHO-Hub inklusive Materialflusssystem, Sicherheitsarchitektur und internationalem Vertrauenssiegel.
Einwilligungssysteme mit eingebautem Blankoscheck
Mit einem einzigen Formular (General Consent) dürfen genetische Proben analysiert, unbegrenzt gelagert und international geteilt werden – auch mit Partnern in Ländern ohne angemessenen Datenschutz. Das ist legal, aber kaum jemand versteht es wirklich.
Kombination mit zahlungskräftigen Patienten
Internationale Kunden liefern – bewusst oder nicht – erstklassige genetische Datensätze. Und sie geniessen ein Umfeld, das medizinisch, logistisch und rechtlich bestens vorbereitet ist.
Machen das alle Länder so?
Nein. Viele Länder haben:
- striktere Datenschutzgesetze
- weniger Vertrauen in internationale Probenweitergabe
- keine WHO-Partnerschaft auf diesem Level
- keine Kombination aus Spitzenspital, Biobank, Genomik und WHO-Gateway.
Selbst Länder mit starker Biotechnologie (USA, UK, China) machen das nicht so transparent-inoffiziell wie die Schweiz. Sie nutzen meist staatliche oder militärische Labore, aber nicht Spitäler mit Patientenverkehr und WHO-Fassade.
Die Schweiz hat mit Spiez, Inselspital, sitem-insel, Biobank & WHO-BioHub ein biopolitisches Nervenzentrum geschaffen, das weder demokratisch breit legitimiert noch im öffentlichen Bewusstsein verankert ist. Die Brisanz liegt nicht in einem einzelnen Labor oder einer Biobank, sondern in der stillen, systematischen Kopplung all dieser Elemente zu einem Machtinstrument im Gesundheitsgewand. Und gerade weil alles legal aussieht, gut gemeint klingt und „für die Menschheit“ geschieht, ist es so gefährlich: Wer friedlich wirkt, darf fast alles.
Offene Fragen
was wir dringend klären müssen:
- Wer hat das demokratisch legitimiert? Die Schweiz hat sich mit Labor Spiez und Inselspital in das Herzstück des WHO-BioHub-Systems eingebunden – ohne öffentliche Diskussion, parlamentarische Debatte oder Volksabstimmung. Ist das noch föderal oder schon technokratisch?
- Wer entscheidet über die Nutzung der Proben? Internationale Forschungsinstitute, Pharmakonzerne und WHO-Gremien erhalten Zugriff – nicht aber die Patienten, deren Proben und Daten genutzt werden. Gibt es transparente Kriterien? Oder öffnet sich hier ein Goldrausch im Namen der Gesundheit?
- Wie weit ist die Verknüpfung mit digitalen Gesundheitsausweisen? Mit der Einführung digitaler Impfzertifikate und WHO-Gesundheitsausweise entstehen globale Bio-Identitäten. Werden Biobank-Daten künftig Teil eines umfassenden Gesundheitsprofils verknüpfbar mit Ethnie, Genetik, Reisestatus?
- Wer kontrolliert die WHO auf Schweizer Boden? Die WHO ist als internationale Organisation immun – juristisch, politisch und operativ. Wenn in Spiez etwas schiefläuft oder missbraucht wird: Wer trägt Verantwortung? Das BABS? Der Bundesrat? Niemand?
- Ist das wirklich ein Pilot oder längst permanent? Obwohl offiziell als temporär deklariert, wird massiv investiert: Laborneubauten, Untertage-Infrastruktur, Vertragsverlängerungen bis 2027. Wurde hier ein globales Viren-Drehkreuz etabliert, ohne dass die Bevölkerung davon weiss?
Diese Fragen sind nicht rhetorisch. Sie sind überfällig.
Nachwort: Es geht nicht nur ums Geschäft – es geht um Kontrolle
Was in der Schweiz entsteht, ist keine normale Forschungskooperation. Es ist auch kein gewöhnliches Public-Health-Programm. Es ist ein globales Steuerungsinstrument im Biogewand. Aufgebaut ausgerechnet in einem Land, das sich neutral und humanitär gibt.
Labor Spiez, WHO-BioHub, Biobank am Inselspital: Das alles sieht nach Vorsorge aus, nach Schutz. Doch die verwendeten Technologien, synthetische Genome, Gain-of-Function, genetische Datenbanken, sind nicht bloss medizinisch. Sie sind strategisch. Sie schaffen Macht.
Die Schweiz ist dabei nicht einfach Gastgeberin. Sie ist Teil der Architektur. Freiwillig. Stolz. Und gefährlich still. Denn wer die Plattform stellt, trägt Verantwortung. Auch für das, was darauf geschieht. Es geht nicht nur ums Geschäft mit der nächsten Pandemie. Es geht um die Kontrolle über die Bedingungen, unter denen sie überhaupt entsteht. Wer in diesem Spiel die Infrastruktur stellt, gestaltet mehr als nur die Antwort auf globale Gesundheitskrisen, er gestaltet ihre Möglichkeit.
Warum ausgerechnet die Schweiz dabei eine so zentrale Rolle einnimmt, bleibt für viele Bürger ein Rätsel.

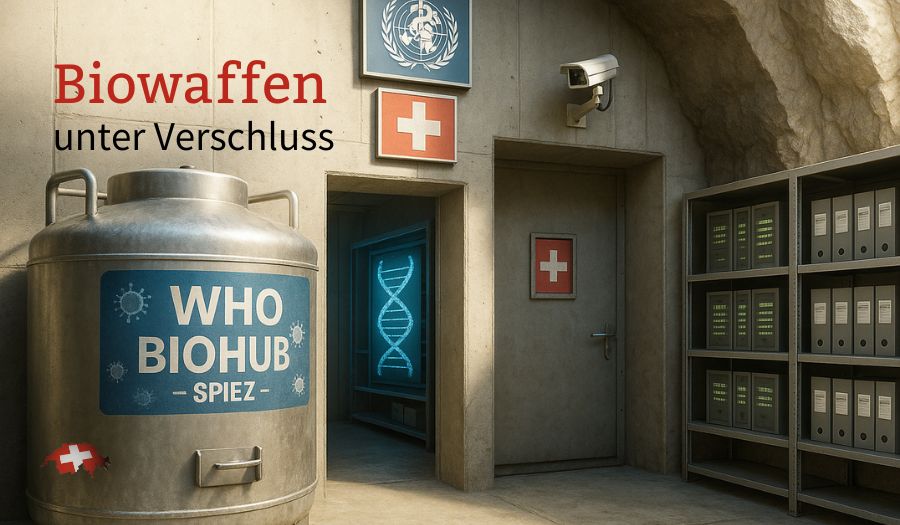








who entmachten. anders wird´s nicht gehen.