Die Schweiz und die WHO:
Ein Lehrstück in unterirdischer Gefolgschaft
Oder: Von der Neutralität zur Nachplappernation
Es beginnt im Schlaraffenland der globalen Gesundheitspolitik, wo SPAR nicht für „Supergünstige Preise am Regal“ steht, sondern für „States Parties Self-Assessment Annual Reporting Tool“. Klingt sexy, ist es aber nicht. Es ist die Selbstvergewisserung eines WHO-Vasallen, dass er brav alles umgesetzt hat, was die nächste Gesundheitsüberwachungs-Iteration verlangt.
Und wer führt hier vorbildlich Buch? Richtig: Die Schweiz mit ihrem Bundesamt für Gesundheit (BAG). Das Land, das bei internationalen Selbstverpflichtungen nie „Ich denke noch mal darüber nach“ sagt, sondern „Wo darf ich unterschreiben, Herr Generaldirektor Tedros?“ – stilecht mit Aktenkoffer unter dem Arm und Kaffeetasse in der Hand, serviert vom diensthabenden BAG-Kaffeenachschenker im Genfer WHO-Backoffice.
Fünf von fünf für den Gehorsam
Was sagt die Schweiz im States Parties Self-Assessment Annual Reporting Tool für 2024?
Der SPAR 2024 der Schweiz wurde erneut vom «National IHR Focal Point» (einer Stelle im BAG) eingereicht. Die Selbsteinschätzung, die ABF Schweiz vorliegt, zeigt ein erstaunlich hohes Mass an Konformität mit den WHO-Vorgaben:
- C1.1 Gesetzliche Grundlagen: Die Schweiz bewertet sich auf Stufe 5 von 5. Begründung: Das Epidemiengesetz ist in Kraft, eine Revision ist in Vorbereitung und soll 2027 abgeschlossen sein.
- C1.2 Gender Equality (Gleichstellung der Geschlechter) in Notlagen: Auch hier stuft sich die Schweiz hoch ein (Stufe 5 von 5). Erwähnt werden das Gleichstellungsgesetz von 1995 und eine Strategie auf Bundesebene.
- C2.1 bis C2.3 IGV-Koordination und Interessenvertretung: Die Schweiz gibt an, alle Mechanismen seien vorhanden und in Umsetzung. Die Einbindung aller Sektoren sei gewährleistet. Dreimal Stufe 5 von 5.
- C3 Finanzierung: Die Schweiz erkennt Herausforderungen an, bescheinigt sich jedoch eine vorausschauende Planung und Mechanismen zur Mittelverwendung (Stufe 5 von 5).
- C4 Labore: Auch hier hohe Bewertungen – inklusive Biosicherheit, Qualitätsmanagement und nationalem Diagnostiknetzwerk. Fünfmal Stufe 5 von 5.
- C5 Überwachung: Es gebe zwar Herausforderungen beim Fachkräftemangel und bei der digitalen Transformation, aber die Systeme seien solide und das Dashboard sei in Weiterentwicklung. Zweimal Stufe 4 von 5.
- C6 Personalressourcen: Die Schweiz erkennt an, dass qualifiziertes Personal entscheidend für die Umsetzung der IHR ist. Sie bescheinigt sich eine gute Grundstruktur, verweist aber selbst auf Herausforderungen bei der Rekrutierung und beim Aufbau von Fachwissen – insbesondere im Bereich der digitalen Gesundheitsüberwachung. Die personelle Notfallreserve sei planbar, aber nicht durchgehend gesichert. Einmal Stufe 3 und einmal 5.
- C7 Notfallmanagement: Hier zeigt sich das typische Schweizer Selbstbild: geplant, organisiert, einsatzbereit. Die Schweiz bewertet sich in den drei Teilbereichen (Planung, operative Führung, Logistik) mit Stufe 3 und 4 – also durchaus selbstkritischer als in anderen Kapiteln. Dennoch verweist sie auf bestehende Strukturen, eingeübte Abläufe und koordinierte Systeme. Die WHO-Kompatibilität wird auch hier als selbstverständlich angenommen. Auffällig ist jedoch: Eine echte Aufarbeitung der Covid-Erfahrungen – etwa mit Blick auf überlastete Versorgung, Versorgungslücken oder Versorgungskonzepte für vulnerable Gruppen – findet nicht statt.
- C8 Gesundheitsdienstleistungen: Die Schweiz stuft sich in zwei Teilbereichen mit 4 von 5 und einmal mit der Höchststufe 5 ein – ein nahezu vollständiger «Vollzug». Sie erklärt, das Fallmanagement, der Zugang zu Gesundheitsleistungen und die Sicherstellung sogenannter «essentieller Gesundheitsdienste seien jederzeit gewährleistet. Was konkret unter «essentiell» fällt, bleibt jedoch offen. Die Bewertung blendet zudem aus, dass während der Covid-Pandemie zahlreiche Leistungen – von Krebsdiagnostik über Reha bis hin zu Physiotherapie – teils massiv eingeschränkt oder verschoben wurden.
- C9 Infektionsprävention und -kontrolle (IPC): Die Schweiz bewertet sich positiv. Überwachung von nosokomialen Infektionen (Krankenhausinfektionen), sichere Umgebungen in Einrichtungen und umfassende IPC-Programme seien etabliert. Zweimal Stufe 4, einmal 5. Auch hier: Die kritische Reflexion bleibt aus. Die Frage, wie effektiv Schutzkonzepte in der Praxis waren – etwa in Altersheimen – wird nicht thematisiert.
- C10 Risikokommunikation und Einbindung der Bevölkerung: Die Schweiz sieht sich gut aufgestellt. Sie verweist auf Systeme zur Risikokommunikation, Community Engagement (Einbindung der Bevölkerung) und multisektorale Kommunikationsstrukturen. Doch gerade hier stellt sich die Frage: Was gilt künftig als «gute Kommunikation»? Und wer entscheidet, wann eine abweichende Meinung zur «Desinformation» wird? Dreimal Stufe 5 von 5.
Spiez: Das Schönwettermärchen vom Labor-Neubau
Aber nicht nur auf dem Papier wird WHO-Kadavergehorsam geübt. Auch in Beton gegossen, genauer: in die Alpen hinein gegraben. In Spiez wird das „WHO-BioHub“-Labor neu gebaut. Offiziell, weil das alte über 40 Jahre alt ist. Inoffiziell? Wer weiss. Es könnte auch der diskrete Umbau zu einem unterirdischen Pathogen-Hochsicherheitszentrum der NATO-Bio-Strategen sein. Immerhin: Die Kiesgrube gegenüber ist plötzlich weg. Zutritt verboten. Google Maps? Veraltet. Zufall?
Die Schweizer Bürger fragen sich vielleicht, warum niemand im Parlament so richtig darüber reden will. Vielleicht, weil WHO + OPCW + NATO + ABC + BSL-4 zu viele Grossbuchstaben auf einmal sind? Oder weil ein Spiez mit Tunnel und Immunitätsstatus schlecht in den Alpenidyll-Reiseführer passt? Oder weil in Bern inzwischen mehr Leute mit Titeln als mit Textverständnis sitzen?
Gendergerecht im Ausnahmezustand
Wirklich bewundernswert ist jedoch, wie das BAG seine Genderanalyse in Notlagen bewertet: 5 von 5. Es lebe die Gleichstellung – auch beim Maskentragen, Boostern und Isolieren. Schade nur, dass dabei kein Wort darüber verloren wird, wie viele Schwangere eigentlich durch die Massnahmen psychisch belastet wurden, oder ob die WHO für sie auch mal eine Selbsteinschätzung gemacht hat.
Risiko“kommunikation“ als Einbahnstrasse
Auch bei der „Risk Communication“ gibt sich das BAG selbst Bestnoten. Offen bleibt, ob darunter das Löschen unerwünschter YouTube-Videos, das Einrichten von Desinformationsstäben oder das Degradieren kritischer Stimmen angeblich zu staatsgefährdenden Abweichlern fällt. Oder wie das Bundesamt „Community Engagement“ definiert – ausserhalb von geübtem Zustimmungsnicken. Vielleicht als „Fragen stellen, aber bitte leise“, oder „Mitreden, solange man mitredet“. In der Praxis scheint „Einbindung der Bevölkerung“ vor allem eines zu bedeuten: Informationskampagnen mit freundlicher Stimme und schockierten Models auf Plakaten, die suggerieren, dass du ohne Maske, Spritze oder Tracker entweder deine Grossmutter tötest – oder zumindest ein schlechter Mensch bist.
Community Engagement à la BAG heisst auch:
Diskussionsrunden ohne Diskussion, Beteiligungsformate ohne Beteiligung und Expertenpanels mit immer denselben Experten. Denn echte Teilhabe ist schwierig, wenn kritische Fragen als „wissenschaftsfeindlich“, „unsolidarisch“ oder „rechtsesoterisch“ markiert werden, bevor sie überhaupt ausgesprochen sind.
Die Schweiz, WHO-treu wie ein Golden Retriever
Man kann es drehen und wenden wie man will: Das BAG ist kein Bundesamt für Gesundheit mehr, sondern eine WHO-Aussenstelle mit Fondueabenden. Statt kritischer Reflexion gibt’s Selbsteinschätzungsromantik. Statt demokratischer Kontrolle gibt’s eine Orgie aus Koordinationsgremien, Taskforces und sektorübergreifenden Lenkungsausschüssen – alle brav WHO-zertifiziert und garantiert bürgerfern.
Wer hätte gedacht, dass die Eidgenossenschaft einst zur Musterschülerin eines globalen Technokratie-Programms wird – mit Aktenkoffer, Kaffee und Tunnel zum Erregerparadies?
Und irgendwo lacht Tedros. Und sein Kaffeenachschenker schenkt nach und reicht Basler Leckerli.
Denn eines ist klar:
Wer sich der WHO so konsequent andient wie die Schweiz, wird nie von sich aus sagen: „Stopp! Wir machen beim globalen Pandemieregime nicht mehr mit.“ Das sogenannte Opting-out (Widerspruch) bei den Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV) wäre nicht nur ein diplomatischer Affront gegenüber Genf, sondern auch ein Karrierehindernis für alle, die von der WHO-Lobby zur UNO, zur GAVI oder zur Gates-Stiftung weiterwandern möchten.
Der Bundesrat wird die IGV-Reform durchwinken – freundlich lächelnd, souverän klingend, aber ohne jede Souveränität. Die Schweiz bleibt brav. Und brav bleibt brav gefährlich.

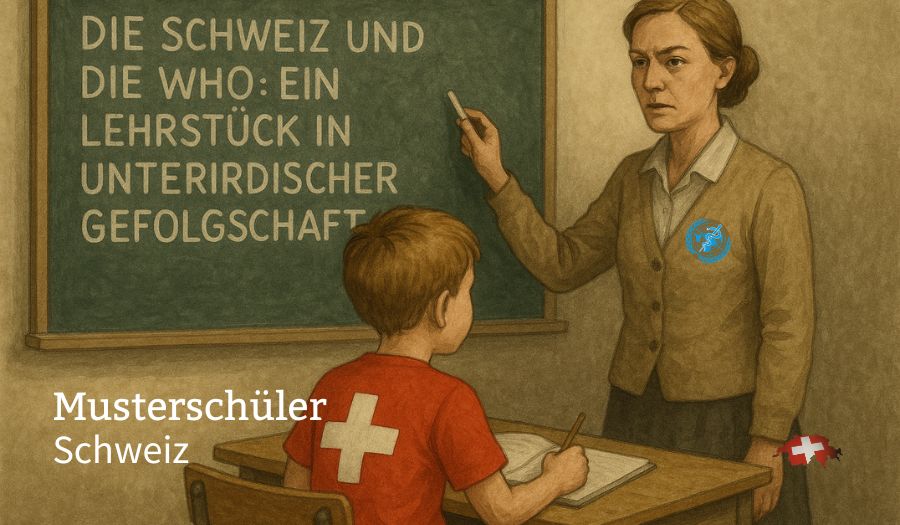
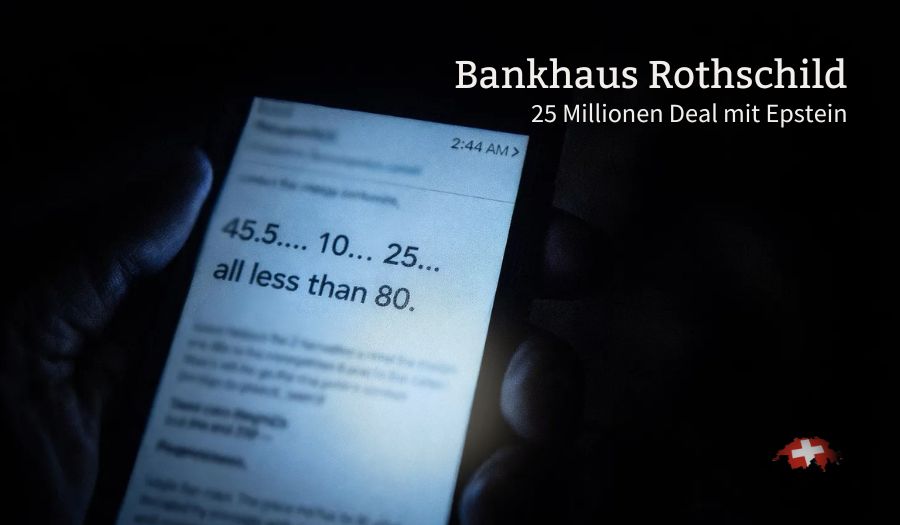







0 Comments