Nächste PABS-Runde in Genf
Die Schweiz liefert, die WHO verwaltet und das Volk darf raten
Hinter verschlossenen Türen geht es um mehr als Pathogene – um Macht, Besitz und Schweigen
Nach dem MERS-Tag in Wimmis am 23. Oktober 2025 folgt die nächste Runde der PABS-Verhandlungen Anfang November in Genf. Während in Spiez ein Virus mit 37 Prozent Letalität als «Beitrag zur globalen Sicherheit» eingelagert wird, diskutieren in Genf die WHO-Mitgliedstaaten, wie solche Transfers künftig automatisch und verpflichtend ablaufen sollen. Kurz gesagt: Der «MERS-Tag» war die Generalprobe für das neue Pathogen Access and Benefit-Sharing-System (PABS), ein globales Tauschsystem für Erreger und deren genetische Informationen, verwaltet von der WHO.
Ein Land als Labor und Legitimationsquelle
Die Schweiz spielt in dieser Geschichte eine Doppelrolle: Sie ist Gastgeberin der WHO und zugleich Laborantin der Weltgemeinschaft. Spiez war das erste BioHub-Labor, das lebende Pathogene im Auftrag der WHO annahm. Was damals als «Pilotprojekt» begann, wird nun mit dem PABS-System zur globalen Pflicht. Nur dass der neue Vertrag keine Freiwilligkeit mehr kennt.
Die Mitgliedstaaten sollen Pathogene und Sequenzen innerhalb von 48 Stunden teilen, mit der WHO, wohlgemerkt, nicht mit dem eigenen Parlament. Die Idee der nationalen Souveränität, einst ein Eckpfeiler der internationalen Zusammenarbeit, wird in Genf zum Relikt aus einer vordigitalen Zeit. Heute heisst das Motto: «Global teilen, national schweigen.»
In Spiez wird die Probe entgegengenommen, katalogisiert, etikettiert und fortan als «globaler Besitz» betrachtet. Die Schweiz stellt Infrastruktur und Glaubwürdigkeit; die WHO verwaltet die Proben, die Daten und das Narrativ. Was die Bevölkerung davon weiss? So gut wie nichts. Denn je technokratischer ein Thema, desto besser lässt sich politische Verantwortung darin auflösen.
Natürlich nur zur Sicherheit.
Wer rettet die Welt und warum anonym?
Auf die Frage, wer im Auftrag der Schweiz in Genf verhandelt, blieb das Bundesamt für Gesundheit (BAG) bislang die Antwort schuldig. Zwei Wochen nach einer Anfrage trudelte eine Reaktion ein, komplett geschwärzt.
Offizielle Begründung: Personenschutz. Inoffizielle Übersetzung: Demokratievermeidung aus Gründen der Effizienz.
Denn während das BAG die Namen versteckt, veröffentlicht die WHO längst Teilnehmerlisten mit Delegierten aller Länder. Ungeschwärzt, alphabetisch und in bestem Verwaltungsenglisch. Die Schweiz übt Transparenz wie Sudoku: man darf raten, aber nie wissen.
Und so verhandeln in Genf Menschen, die sich offenbar selbst vor ihren Mitbürgern fürchten. Vielleicht, weil sie wissen, dass es hier nicht um Gesundheitsvorsorge geht, sondern um den Umbau eines souveränen Rechtsrahmens in ein global verwaltetes Biosystem.
Oder weil sie ahnen, dass das, was als «fairer Vorteilsausgleich» verkauft wird, in Wahrheit die Generalvollmacht für die WHO ist, in jedem Land Zugriff auf genetische Ressourcen und Daten zu erzwingen.
In Bern nennt man das Vertrauen. In Spiez nennt man es Gehorsam.
Das PABS-System – oder: Die feine Kunst des Besitzverzichts
Unter der sanften Sprache von «Access» und «Benefit-Sharing» verbirgt sich ein radikales Konzept: Staaten sollen biologische Materialien, Sequenzdaten und alles, was daraus entsteht, nicht mehr als ihr Eigentum betrachten, sondern als Teil eines globalen Guts. Klingt edel, bis man fragt, wer dieses Gut verwaltet.
Antwort: Die WHO. Und ihre sogenannten «System Partners». Darunter GAVI, UNICEF, die Weltorganisation für Tiergesundheit und natürlich die «Privatsektoren».
Das ist der neue Multistakeholderismus: Staaten zahlen, Konzerne profitieren, NGOs liefern die moralische Verpackung. Und das alles im Namen der Gerechtigkeit. In Genf nennt man das «Equity». In Bern würde man es steuerfinanzierte Naivität nennen, wenn man es denn verstehen wollte.
Die WHO verspricht, dass alle Hersteller, die Zugang zu diesen Daten erhalten, im Gegenzug «benefits» liefern müssen: zehn Prozent ihrer Produktion gratis, zehn weitere zu fairen Preisen. Doch wer definiert «fair»? Genau: die WHO. Die gleiche Organisation, die während der letzten Pandemie nirgends für Liefergerechtigkeit sorgen konnte, dafür aber den Begriff «Solidarität» in Dauerschleife beschwor.
Vielleicht lagert Spiez nicht nur Erreger, sondern auch Verantwortungen tiefgekühlt.
Die EU-Idee und der Widerstand dagegen
Zwischen den Zeilen der WHO-Verhandlungen spielt sich ein diplomatischer Krimi ab. Die Europäische Union brachte am 17. Oktober 2025 einen Vorschlag ein, der unter dem Titel «Zugang und freiwilliges Teilen» lief. Klingt harmlos, bedeutet aber: freier Zugang zu allen Pathogenen und Sequenzen, aber nur freiwillige Gegenleistungen.
Benefit-Sharing als moralisches Angebot, nicht als Pflicht. Mit diesem Trick wollte Brüssel die alten kolonialen Linien digitalisieren: gratis Rohstoffe, diesmal in Form genetischer Daten.
Das stiess auf massiven Widerstand. Die Länder des globalen Südens und selbst einige EU-Staaten weigerten sich, eine solche Schieflage zu unterschreiben. Denn ohne verbindliche Gegenleistung würde das PABS-System zur Einbahnstrasse: Daten nach Norden, Patente nach Westen, Verantwortung nach nirgendwo.
Das WHO-Büro musste eingreifen und legte den sogenannten «Skeleton Draft» vor. Eine abgespeckte, formell ausgewogene, aber inhaltlich zahnlose Version. Von «gleichberechtigtem Austausch» blieb die Rhetorik, nicht die Realität.
Die Schweiz schwieg offenbar. Kein Wort, kein Vorschlag, keine Kante. Jedenfalls findet sich offiziell nichts (wie immer).
Sie spielt die neutrale Zuschauerin, die alles versteht und nichts sagt. Vielleicht, weil das eigene Spiez-Modell perfekt in die EU-Logik passt: Zugang gesichert, Kontrolle abgegeben, Ethik als Dekoration.
Exkurs: Von Nagoya zu Genf – wie man Souveränität outsourct
Bevor die WHO das PABS-System erfand, gab es das Nagoya-Protokoll. Ein völkerrechtliches Abkommen von 2014, das eines versprach: Staaten behalten die Kontrolle über ihre biologischen Ressourcen. Kein Zugriff ohne Zustimmung, keine Nutzung ohne Vertrag. Kurz: nationale Hoheit in Reinform.
Und nun, elf Jahre später, übergibt die Schweiz dieselben Ressourcen freiwillig an ein System, das genau dieses Prinzip aushebelt. Pathogene und Sequenzdaten werden an die WHO übermittelt, ohne, dass die Schweiz nachvollziehbar dokumentiert, wie die Zustimmung erfolgte oder welche Gegenleistungen vereinbart sind. Damit wird das Nagoya-Prinzip faktisch neutralisiert.
Was einst als Bollwerk gegen Biopiraterie gedacht war, verwandelt sich in einen Freipass für globale Verwaltung. Der Unterschied? Früher brauchte man Verträge, heute genügt Vertrauen.
Der EU-Vorschlag vom 17. Oktober 2025 verschärft dieses Paradox noch: Er beansprucht «specialised instrument»-Status unter Artikel 4.4 des Nagoya-Protokolls, also eine Ausnahme, die nur gilt, wenn das neue System nicht den Zielen von Nagoya widerspricht. Genau das aber tut es. Und die Schweiz? Sie schweigt und liefert brav weiter.
Es ist ein juristisches Kunststück, das selbst Kafka gefallen hätte: Ein Land kann gleichzeitig Vertragspartner und Vertragsverletzer sein, einfach, weil niemand nachrechnet.
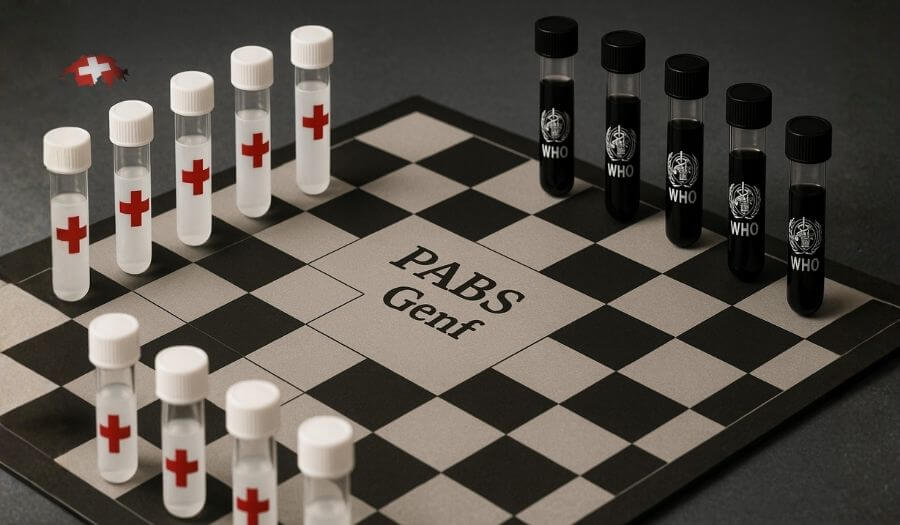
Von der Probe zur Politik
Während Spiez Erreger katalogisiert, schiebt Genf Paragraphen. Das ist die neue Arbeitsteilung: Die Schweiz liefert das Material, die WHO schreibt die Regeln. Und das Volk darf hoffen, dass beides in sauberen Händen bleibt.
Doch genau hier beginnt die Ironie: Der PABS-Entwurf betont zwar das «Recht der Staaten auf ihre biologischen Ressourcen», verpflichtet sie aber gleichzeitig, ihre nationalen Gesetze so anzupassen, dass sie mit dem WHO-System kompatibel werden.
Ein genialer juristischer Taschenspielertrick: Wer sich unterwirft, darf sich weiter souverän nennen.
Wenn also ab dem 3. November in Genf die nächste Verhandlungsrunde startet, wäre es interessant zu wissen, wer für die Schweiz am Tisch sitzt. Vielleicht dieselben unsichtbaren Menschenfreunde, die auch das BioHub-Memorandum unterzeichnet haben, jenen Vertrag, den das Parlament nie vorab gesehen hat, der aber seither als Blaupause für das neue globale Modell dient.
Oder, um es mit Spiez zu sagen: «Versuch geglückt.»
Die Generalprobe in Wimmis
Der «MERS-Tag» war kein Zufall. Er war Symbolpolitik in Reinform: Das Labor Spiez demonstrierte Loyalität, die WHO dankte mit Pressefotos und der Versicherungsindustrie lief das Herz über.
Alles funktionierte, wie es das Drehbuch vorsah. Kein Skandal, keine Debatte, kein Interesse. Nur ein weiteres Stück Schweizer Präzisionsarbeit im Dienst der globalen Biosicherheit.
Und so wird die Schweiz, das Land, das die Neutralität erfand, nun zum Proof of Concept für die globale Biosouveränität der WHO. Ein Land, das alles richtig machen will, aber dabei seine eigenen Grenzen nicht mehr sieht.
Souveränität im Schwärzen
Die Schweiz präsentiert sich nach aussen als Hort der Neutralität und inneren Vernunft. In Wahrheit ist sie längst Testfeld für globale Steuerungssysteme, in denen demokratische Kontrolle nur noch als nostalgische Fussnote vorkommt.
Erst schwärzen, dann unterschreiben, dann erklären, man sei «souverän». Das Prinzip funktioniert erstaunlich gut: Keine Information, keine Desinformation. Und wer fragt, gilt als Störung im Betriebsablauf.
Vielleicht sollte man das Spiez-Protokoll künftig gleich mit schwarzer Tinte drucken. Das spart Arbeit.
Wer sitzt in Genf?
Wer also in Genf am Tisch sitzt, wenn die WHO ab 3. November die PABS-Verhandlungen fortsetzt, bleibt vorerst ein Staatsgeheimnis. Wir werden nachfragen. Wieder.
Vielleicht erfahren wir diesmal, welcher Schweizer Menschen- und Virenfreund im Namen der Eidgenossenschaft spricht.
Bis dahin bleibt nur die Gewissheit: Während Spiez Viren einlagert, lagert Bern Verantwortung aus. Und das Volk?
Darf weiter hoffen, dass Souveränität irgendwann mehr bedeutet als ein Geschwärzwisch in einem PDF.
Aber die gute Nachricht: PDFs kann man schwärzen. Schweizer nicht. Noch nicht.

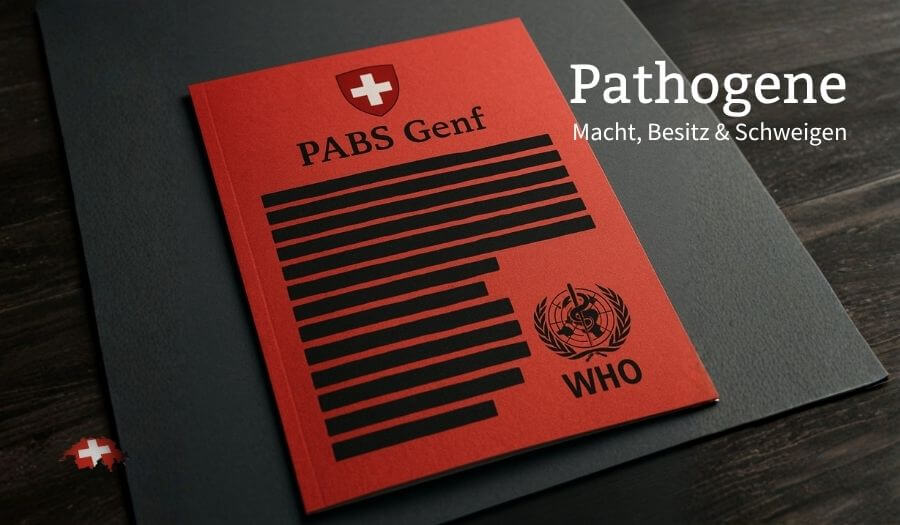

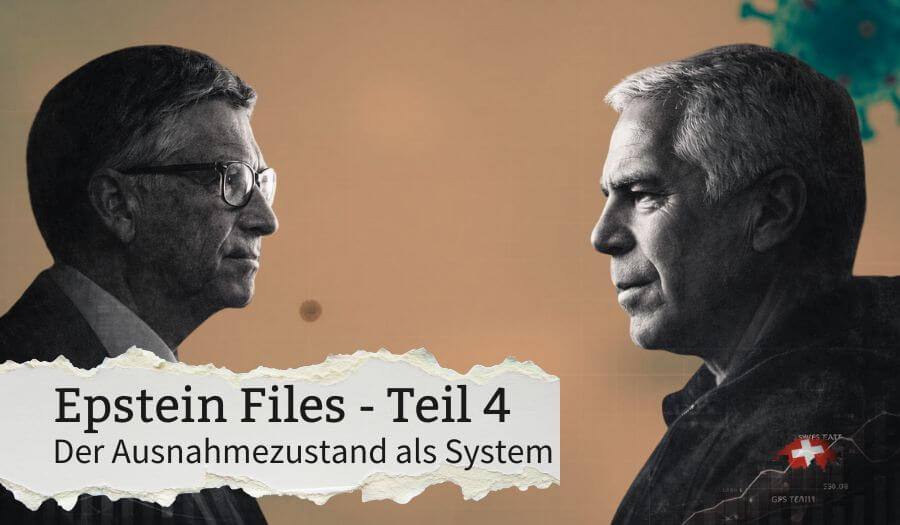


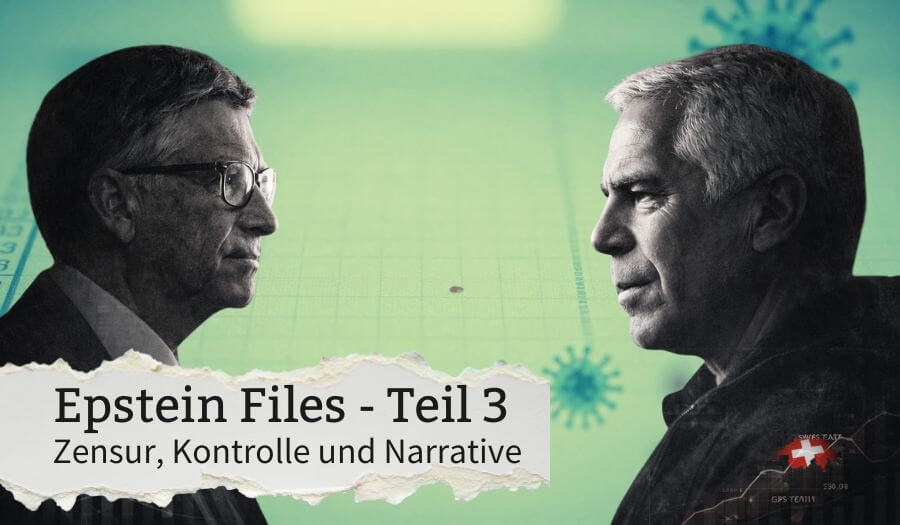



Spontan fiel mir dazu nur; Demonstrieren ein, wenns sein muss jeden Monat oder jede Woche. Doch würde das wohl auch nichts nützen, oder? Nur wenn ~700`000 Menschen kämen, und nicht einmal dann wäre ein Erfolg sicher. Was also können wir tun? Kann eine Volksabstimmung das Unheil abwenden?