Sprechpuppen oben – Strippenzieher unten
Wie Staatssekretäre, Technokraten und ihre Netzwerke die Demokratie durch Verwaltung ersetzen
Der Mythos der sieben Weisen
Man liest jetzt immer häufiger in Kommentaren (vor allem digital) sinngemäss: Der Bundesrat muss weg! Das mag zwar nicht schaden, ist aber nicht des Pudels Kern. Der Bundesrat ist bestenfalls Exekutivgremium, schlimmstenfalls Maskenensemble: austauschbar, farblos, ablesend. Wer glaubt, durch Neubesetzungen in der Regierung die politische Richtung substanziell zu verändern, unterschätzt die tief verwurzelte Macht der Verwaltung. Es ist die Technokratie unterhalb der Ministerebene, die Kontinuität sichert, unabhängig vom Volkswillen. Wer wirklich verstehen will, warum sich in der Schweiz selbst nach verlorenen Volksabstimmungen oft nichts ändert, sollte den Blick nicht nach oben, sondern nach unten richten: zur Verwaltungsspitze, zu den Staatssekretären und Generalsekretären. Dort wird gelenkt, dort wird gebremst, dort wird durchgezogen. Der Bundesrat führt nur auf dem Papier. Die Realität sieht anders aus. Es sind die Staatssekretäre und ihre Verwaltung, die täglich das Staatsgetriebe bewegen und dabei immer häufiger eigene politische Agenden umsetzen, fernab demokratischer Kontrolle.
Die wahre Exekutive: Staatssekretäre und ihre Stäbe
Die Bundesverwaltung umfasste im Jahr 2023 rund 43’000 Mitarbeitende (38‘596 Vollzeitstellen) , verteilt auf sieben Departemente, die Bundeskanzlei und rund 70 weitere Verwaltungseinheiten (z.B. Bundesamt für Gesundheit (BAG), Bundesamt für Statistik (BFS), Bundesamt für Umwelt (BAFU), Bundesamt für Polizei (fedpol), Bundesamt für Kommunikation (BAKOM), Bundesamt für Verkehr (BAV), Bundesamt für Energie (BFE), Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL), Schweizerisches Tropen- und Public Health-Institut (Swiss TPH), armasuisse (Beschaffungsorganisation des VBS) und viele weitere).
Und genau dort sitzt das eigentliche Flüstern der Macht
Diese Ämter und spezialisierten Verwaltungseinheiten agieren längst nicht mehr nur als verlängerter Arm der Politik. Sie sind oft deren heimliche Architekten. Sie liefern die Argumente, die Zahlen, die Strategien. In internen Memos, Hintergrundgesprächen oder sogenannten „Faktenblättern“ werden sie zu den Pferdeflüsterern des Bundesrats: diskret, aber einflussreich.
Noch brisanter: Einige dieser Einheiten pflegen enge Kooperationen mit privaten Akteuren, Thinktanks und Philanthrokapitalisten. So etwa das Schweizerische Tropen- und Public Health-Institut, das öffentliche Aufträge mit privaten Zuwendungen kombiniert, etwa von Stiftungen, die global mitmischen wollen. Die Folge: Eine politisch hochrelevante, aber demokratisch kaum kontrollierte Grauzone.
Wer also die Staatssekretäre unter die Lupe nimmt, muss diese Netzwerke gleich mitdenken: jene Ämter, Institute und Fachstellen, die viel mehr sind als nur „Verwaltung“. Sie sind Teile einer strategischen Schaltzentrale und sollten denselben demokratischen Prüfstand durchlaufen wie ihre Chefs.
Fallbeispiel 1: Wer finanziert eigentlich das Schweizer Tropeninstitut (Swiss TPH)?
Offiziell ist das Swiss TPH eine angesehene Forschungseinrichtung mit Sitz in Basel und bekannt für Expertise in Public Health, Epidemiologie und Tropenmedizin. Finanziert wird es vom Bund, vom Kanton Basel-Stadt und von internationalen Partnern. Aber wer genauer hinsieht, entdeckt ein spannendes Muster:
- Private Stiftungen und Geldgeber mit globaler Agenda – darunter auch die Gates Foundation, Wellcome Trust und andere philanthrokapitalistische Akteure, die sich offiziell für globale Gesundheit einsetzen.
- Internationale Organisationen wie die WHO oder die Weltbank vergeben Forschungsaufträge – mit politischen Implikationen.
- Gleichzeitig arbeitet das TPH eng mit Bundesstellen wie dem BAG, dem SEM oder dem EDA zusammen und beeinflusst damit auch die politische Entscheidungsgrundlage.
- Dr. Tracy Glass, Gattin von Bundesrat Beat Jans, ist Leiterin der Clinical Statistics and Data Management beim TPH und verantwortlich u.a. für WHO-Studien oder Studien für die Impfallianz von Bill Gates GAVI oder zur Pandemievorsorge. Und nicht zu vergessen EU-Gelder aus dem Horizon-Topf gibt es auch noch.
Beat Jans gilt als überzeugter Europäer. Er lobte zuletzt den „Swiss-like safeguard clause“ im neuen EU-Abkommen und stellte fest: „If the British had this, there’d have been no Brexit“. Das nur am Rande.
Was dabei entsteht, ist eine Drehscheibe zwischen Forschung, Politik und globalen Interessen – mit wenig Transparenz und noch weniger demokratischer Kontrolle.
Wer denkt, dass hier nur geforscht wird, irrt. Swiss TPH schreibt Berichte, evaluiert Massnahmen, sitzt in internationalen Panels und beeinflusst so, welche gesundheitspolitischen Prioritäten gesetzt werden. Der Bundesrat hört zu. Die Verwaltung übernimmt. Und das Volk? Wird informiert, wenn alles längst entschieden ist.
Fallbeispiel 2: armasuisse – Wenn Beschaffungspolitik zur strategischen Macht wird
Offiziell ist armasuisse die Einkaufszentrale des Bundes für alles, was mit Sicherheit zu tun hat: Flugabwehrsysteme, Funktechnik, Satelliten, Cyberabwehr. Was kaum bekannt ist: armasuisse entscheidet mit, was gekauft, getestet, priorisiert und ausgebaut wird, noch bevor politische Entscheide überhaupt gefällt sind.
Ein paar Zahlen zur Einordnung:
- armasuisse verwaltet jährlich mehrere Milliarden Franken, etwa für den Rüstungs- und Entwicklungsplan.
- Die Behörde arbeitet eng mit internationalen Industrienetzwerken, NATO-nahen Thinktanks und Forschungsclustern zusammen.
- Mit dem „Cyber Defence Campus“ unterhält armasuisse sogar ein eigenes Forschungs- und Innovationszentrum an der Schnittstelle von Armee, Universitäten und Tech-Industrie.
Was bedeutet das politisch?
- Wer mit armasuisse spricht, verhandelt nicht nur über Preise, sondern über Prioritäten und Strategien.
- Sicherheitsdoktrinen entstehen dort oft im Vorfeld parlamentarischer Prozesse und stecken den Rahmen ab, in dem der Bundesrat dann „entscheiden“ darf.
- Kritische Öffentlichkeit? Fehlanzeige. Denn Beschaffung gilt als „technische Materie“. Dabei ist sie in Wahrheit hochpolitisch.
Auch hier gilt: Die Verwaltung agiert längst nicht mehr neutral, sondern setzt Schwerpunkte mit geopolitischem Gewicht. Und wenn sich ein Bundesrat oder Parlament mal querlegt? Dann sind Dossiers, Partner und Verträge oft längst vorbereitet.
Die Staatssekretäre
Unterhalb der Bundesräte operieren die Staatssekretäre: hochdotierte Spitzenbeamte, die mit weitreichenden Kompetenzen ausgestattet sind. Zurzeit gibt es sechs aktive Staatssekretäre. Diese sind fünf der sieben bestehenden Departemente zugeordnet:
- EDA: Staatssekretariat für auswärtige Angelegenheiten (Alexandre Fasel)
- WBF: Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO, Helene Budliger Artieda & Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI, Martina Hirayama)
- EFD: Staatssekretariat für internationale Finanzfragen (SIF, Daniela Stoffel)
- EJPD: Staatssekretariat für Migration (SEM, Vincenzo Mascioli)
- VBS: Staatssekretariat für Sicherheitspolitik (SEPOS, Markus Mäder)
Das bedeutet auch: Zwei Departemente, das EDI (Inneres) und das UVEK (Umwelt, Verkehr, Energie, Kommunikation), verfügen aktuell über kein eigenes Staatssekretariat.
Dazu kommt, mit Sonderstatus, das Generalsekretariat im EDA unter der Leitung von Markus Seiler, zuständig für „Public Diplomacy“ über die Einheit Präsenz Schweiz. Dieses Generalsekretariat übernimmt nicht nur interne Verwaltungskoordination, sondern auch den weltweiten Auftritt der Schweiz nach aussen, von Imagekampagnen über Expo-Pavillons bis hin zu Imagekrisenmanagement. Es untersteht formal direkt Bundesrat Cassis, agiert aber strategisch eigenständig und medienwirksam.
Anmerkung: Damit hat die Diversitätskulisse offenbar Risse bekommen: Nur noch drei von sechs Staatssekretariaten sind mit Frauen besetzt. Der Apparat wird nicht weiblicher oder männlicher, er bleibt einfach mächtiger als gewollt. Und vor allem: weiter unerreichbar für demokratische Kontrolle.
Ein Staatssekretariat wie das SECO beschäftigt hunderte Mitarbeitende und steuert direkt Teile der Schweizer Wirtschafts-, Aussenhandels- und Standortpolitik. Der Staatssekretär ist nicht nur Berater des Bundesrates, sondern oft selbst Akteur: Er sitzt in internationalen Gremien, verhandelt mit der EU oder OECD, gibt Studien in Auftrag, prägt die Kommunikation und beeinflusst den politischen Diskurs.
Diese Posten sind keine Schreibtischtänze. Sie sind Machtzentralen mit hohem Gestaltungsspielraum und meist komplett ausserhalb medialer und öffentlicher Aufmerksamkeit.
Verwaltung als Staat im Staat
Bundesräte kommen und gehen. Die Verwaltung bleibt. Und mit ihr jene, die die Abläufe, Netzwerke und Schwachstellen der Politik bis ins Detail kennen. Wer zwei Jahrzehnte in einem Departement überlebt hat, ist kein „Sachbearbeiter“ mehr, sondern ein strategischer Akteur. Die Verwaltung entscheidet faktisch über Umsetzungstempo, Interpretationen von Volksentscheiden und die konkrete Ausformulierung von Verordnungen.
Ob beim WHO-Pandemievertrag, der Revision der Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV) oder dem EU-Rahmenabkommen: Die Entwürfe werden oft durch die Verwaltung vorgefiltert, mitgestaltet und „vorbereitet“. Das Volk sieht eine Vorlage, aber nicht, wie sie entstand. Diese Art von Autonomie ist demokratisch hochproblematisch.
Eigene Agenda, loyale Seilschaften
Immer wieder zeigt sich: Teile der Verwaltung scheinen nicht neutral zu agieren, sondern folgen einer klaren politischen Richtung. Migration, Klima, Digitalisierung, Gesundheitsüberwachung. Wer intern nicht die richtige Haltung vertritt, wird ausgegrenzt, blockiert oder „wegentwickelt“. Der Begriff „Gesinnungskader“ ist nicht übertrieben.
Es geht nicht um geheime Zirkel, sondern um eine schleichende, systemisch begünstigte Veränderung der Staatskultur. Wer so lange im Amt bleibt wie viele Spitzenbeamte, wird zwangsläufig Teil eines engen Netzwerks: Einladung zum Apéro hier, ein Panel dort, ein diskreter Hintergrundlunch mit „Experten“ oder Lobbyisten dazwischen. Nähe entsteht, nicht selten zu viel davon. In der Privatwirtschaft gelten heute strenge Compliance-Vorgaben: Ein Geschäftsessen darf oft nicht mehr als 100 Franken kosten, in Deutschland liegt die Grenze teils bei 20 Euro. Gibt es solche Regeln auch in der Schweizer Verwaltung?
Leider konnten wir keine verlässlichen Quellen finden, dass in der schweizerischen Bundesverwaltung strikte Compliance-Regeln existieren, beispielsweise offizielle Kostengrenzen für Apéros oder Lunch-Einladungen. Es gibt Richtlinien und Ethik-Codes, allerdings bleiben diese oft intransparente Papiertiger ohne wirksame Überprüfung, so Transparency International in ihrem National Integrity System Report Schweiz 2011.
GONGOS
Externe Thinktanks, internationale Organisationen und NGOs wirken jedenfalls auf die Verwaltung ein. Doch NGOs sind heute oft keine unabhängigen zivilgesellschaftlichen Akteure mehr, sondern sogenannte GONGOs – Government-Organized Non-Governmental Organizations. Diese staatsnahen Pseudo-NGOs werden von Regierungen gegründet oder finanziert, um staatliche Interessen zu tarnen, politische Agenden durchzusetzen und sich ein zivilgesellschaftliches Mäntelchen umzuhängen. Sie wirken nach innen wie aussen, greifen in Bildungs-, Migrations- oder Gesundheitspolitik ein und sind strategisch eingebunden in ministerielle Prozesse. Statt als neutraler Filter zwischen Volkswille und Umsetzung zu agieren, wird die Verwaltung zunehmend zum aktiven Player in der politischen Formgebung. Wer sitzt in den Strategiegruppen, Arbeitskreisen, delegierten Gremien? Wer schreibt die Vorlagen? Wer informiert die Medien? Genau: die Verwaltung, gemeinsam mit ihrem GONGO-Netzwerk.
Unsichtbare Macht, keine Schlagzeile wert
Warum wird das nie thematisiert? Ganz einfach: Es fehlt die Story. Ein Bundesrat, der versagt, taugt für Skandale, Headlines und Empörung. Er kann beschuldigt, befragt, medial verbrannt werden. Aber ein Schattenbeamter in einem Bundesamt? Der technokratische Strippenzieher, der im Hintergrund EU-Verhandlungen orchestriert oder WHO-Verträge finalisiert? Zu trocken, zu abstrakt, zu unangreifbar.
Dabei wäre genau das die Aufgabe einer wachen Demokratie: hinzusehen, wer wirklich entscheidet. Wer verfasst die Strategiepapiere? Wer bewegt die Budgets? Wer bestimmt, ob ein internationales Abkommen als „bloss technischer Nachvollzug“ durchgewinkt wird oder dem Volk zur Abstimmung vorgelegt wird? Es sind nicht die Gewählten. Es sind die Beamten, Experten, Staatssekretäre. Und solange niemand hinschaut, bleibt ihre Macht unkontrolliert.
Medien? Beschäftigen sich lieber mit Parteistreits und Showpolitik. Für die systemische Analyse fehlen Zeit, Wille und vielleicht auch Mut.
Fallbeispiele für stille Macht
- WHO-Verträge (IGV & Pandemievertrag): Kein Bundesrat, sondern Verwaltungsleute verhandeln seit Jahren in Genf, oft ohne parlamentarisches Mandat. Wer in den technischen Gremien sitzt, ist oft schon lange vorher festgelegt, demokratische Kontrolle: null.
- EU-Rahmenabkommen: Der Text kommt aus der Verwaltung. Verhandelt wurde in Brüssel, aber vorbereitet wurde alles in Bundesämtern. Das Parlament wurde spät informiert, das Volk noch später.
- Digitale ID & E-ID: Pilotprojekte, Rückmeldeschlaufen, Gesetzesformulierungen orchestriert von Verwaltung und Tech-Lobbygruppen. Die Abstimmung ist dann nur noch symbolisch. Wenn überhaupt.
- Präsenz Schweiz & EDA: Die Schweiz als Marke wird international durchgestylt, von einer Generalsekretariatseinheit. Expo-Pavillons, Storylines, Narrativsteuerung. Alles ohne Legitimation durch das Volk. Reputationspolitik statt Demokratiepolitik.
Die politische Umsetzung des Volkswillens liegt statistisch bei nahezu null
Eine vielzitierte Studie der Politologen Martin Gilens und Benjamin Page aus dem Jahr 2014 hat in den USA gezeigt: Die politische Umsetzung des Volkswillens liegt statistisch bei nahezu null, sobald wirtschaftliche Eliten und organisierte Interessen einbezogen werden. Was die Mehrheit der Bevölkerung will, hat praktisch keinen Einfluss auf die konkrete Regierungspolitik. Und was dort nachgewiesen wurde, lässt sich in der Schweiz längst beobachten. Subtiler, leiser, aber ebenso wirksam. Auch hier dominieren Akteursnetzwerke aus Staatssekretariaten, Verwaltungsspitzen, GONGOs und internationalen Gremien die politische Gestaltung. Ob WHO-Verträge, EU-Abkommen oder digitale Identität (E-ID). Die relevanten Entscheidungen werden längst gefällt, bevor das Volk überhaupt erfährt, dass etwas zur Abstimmung anstehen könnte. Demokratie findet hier nicht mehr statt, sie wird lediglich verwaltet.
Kontinuität schlägt Demokratie
In jeder funktionierenden Demokratie braucht es ein gewisses Mass an Beständigkeit. Ein professioneller Beamtenapparat, der Übergänge absichert, Erfahrung bündelt und staatliches Handeln stabilisiert. Doch wenn diese Stabilität in ein Eigenleben umschlägt, entsteht ein Machtblock, der sich der Kontrolle entzieht. Genau das geschieht derzeit in der Schweiz: Die Staatssekretäre und ihre Verwaltungsspitzen verfügen über eine Kontinuität, die jeder politischen Kontrolle überlegen ist. Während Bundesräte häufig im Vierjahresrhythmus wechseln, bleiben sie jahrzehntelang. Sie kennen die Dossiers besser als jeder Parlamentarier, sie pflegen die internationalen Netzwerke, sie definieren die Umsetzungswege und sie gestalten längst auch Inhalte mit.
Diese faktische Entmachtung der politischen Ebene durch eine selbstbewusste Verwaltung ist nicht neu, aber sie hat sich massiv beschleunigt. Was früher unterstützend und beratend gedacht war, ist heute treibende Kraft geworden. Es entstehen eigendynamische Politikstrukturen, in denen demokratische Legitimation durch „technische Notwendigkeit“ ersetzt wird.
Und genau hier beginnt die Technokratie: eine Regierungsform, in der nicht mehr das Volk entscheidet, sondern angeblich „neutrale“ Experten. Meist ungewählt, unbeobachtet, unantastbar. Technokratie wirkt harmlos, weil sie sich als „wissenschaftlich“ oder „alternativlos“ inszeniert.
Machtmodell ohne politisches Mandat
In Wahrheit ist sie ein Machtmodell ohne politisches Mandat und besonders wirksam dort, wo supranationale Organisationen wie die WHO, die UNO oder Akteure der Agenda 2030 mit am Tisch sitzen. Denn wo Politik globalisiert wird, wird sie zugleich entdemokratisiert. Die Staatssekretäre stehen dabei nicht nur an der Spitze dieser tief verankerten Technokratie, sie sind ihre Gesichter, ihre Vollstrecker und ihre Absicherung. Der demokratische Kipppunkt ist längst überschritten, wenn nicht mehr das Volk, sondern das Protokoll entscheidet.
Und genau hier liegt das eigentliche Problem: Je stärker sich die Verwaltung verselbstständigt, desto weniger bleibt von der vielzitierten Volkssouveränität übrig. Hinter den Kulissen agieren gut vernetzte Apparate, die operativ längst ihre eigene politische Linie verfolgen, legitimiert durch Funktion, nicht durch Wahl. Die Staatssekretäre stehen dabei nicht nur an der Spitze dieser tief verankerten Technokratie, sie sind ihre Gesichter, ihre Vollstrecker und ihre Absicherung. Was als administrative Unterstützung gedacht war, wurde zur zweiten, unsichtbaren Regierungsebene. Kurz: Wer die Exekutive reformieren will, sollte nicht nach oben schauen, sondern eine Etage (und noch) tiefer.
Was tun? 6 Hebel gegen die Schattenmacht
Wie wir die Verwaltung demokratisch zähmen
Wer über direkte Demokratie spricht, darf über die Verwaltung nicht schweigen. Denn genau dort sitzt heute ein beachtlicher Teil der Macht und zwar dauerhaft, gut vernetzt und weitgehend immun gegen Kontrolle von aussen. Reformvorschläge gibt es viele, doch sie bleiben oft an der Oberfläche. Wenn wir wirklich etwas verändern wollen, müssen wir tiefer gehen: in die Strukturen, die Routinen, die persönlichen Verflechtungen.
Dieser Exkurs zeigt, wie wir mit sechs konkreten Hebeln die Macht der Staatssekretäre und ihrer Technokratenriegen zurück in demokratische Bahnen lenken. Fundiert, praxistauglich und mit Blick auf Good Governance. Nicht als Angriff auf die Verwaltung an sich, sondern als Schutzmassnahme gegen Machtkonzentration ohne Mandat.
- Rotation nach dem Wirtschaftsprüfer-Prinzip
Wer zu lange auf einem Posten sitzt, wird betriebsblind, käuflich oder zu bequem für echten Widerspruch. Das weiss man in der freien Wirtschaft seit Jahrzehnten. Deshalb hat der Gesetzgeber in der Schweiz klare Regeln eingeführt: Gemäss Artikel 730a des Obligationenrechts (OR) muss der leitende Revisor (Mandatsleiter) bei einer zugelassenen Revisionsstelle nach spätestens sieben Jahren ersetzt werden. Ziel: Unabhängigkeit wahren, Interessenkonflikte vermeiden und institutionelle Nähe verhindern.
Viele börsenkotierte Unternehmen gehen inzwischen noch weiter. Sie rotieren freiwillig nach vier Jahren den Wirtschaftsprüfer, um gegenüber Öffentlichkeit und Investoren maximale Unabhängigkeit zu demonstrieren.
In der Bundesverwaltung hingegen bleibt alles, wie es ist: Staatssekretäre und ihre engsten Mitarbeiter bleiben oft jahrzehntelang im gleichen Netzwerk, im gleichen Departement, mit den gleichen Loyalitäten.
Deshalb unser Vorschlag: Staatssekretäre rotieren alle vier Jahre, ihre erste Führungsebene auch, quer durch die Departemente. Rotation erzeugt Distanz. Und Distanz schafft Vertrauen: in der Wirtschaft wie in der Verwaltung.
- Parlamentarische Hearings vor Ernennung
Aktuell werden Staatssekretäre vom Bundesrat ernannt, ohne öffentliche Debatte, ohne demokratische Prüfung. Dabei vertreten sie die Schweiz in internationalen Gremien, verhandeln über WHO-Verträge oder EU-Dossiers, oft mit weitreichenden Folgen.
Unser Vorschlag: Jeder Staatssekretär, jeder Chef der Bundeskanzlei und einer der 70 Verwaltungseinheiten muss künftig in einem öffentlichen Hearing vor dem Nationalrat Rede und Antwort stehen. Wo kommt er oder sie her? Welche Positionen wurden in der Vergangenheit vertreten? Welche internationalen Netzwerke bestehen? Wofür steht er oder sie? Wer regieren will, ohne gewählt zu sein, soll sich zumindest erklären müssen.
- Demokratie-Footprint bei Verwaltungsvorlagen
Wir fordern: Transparenzpflicht über Entstehung und Einfluss von Gesetzesentwürfen.
- Wer hat mitgeschrieben?
- Welche NGOs (GONGOS), internationalen Organisationen oder Wirtschaftsberater waren beteiligt?
- Welche externen Dokumente oder Studien wurden als Grundlage verwendet?
All das gehört künftig auf einen offiziellen „Demokratie-Footprint“, vergleichbar einem Co2-Footprint, der jeder Gesetzes- oder Vertragsvorlage beiliegt. Nur so können das Parlament und das Volk erkennen, ob eine Vorlage aus dem Staatsauftrag kommt oder aus der Agenda externer Akteure.
- Unabhängige Demokratie-Kommission mit Aktenzugriff
Kritische Kontrolle darf nicht erst nach der Veröffentlichung kommen. Sie muss davor stattfinden.
Unser Vorschlag: Eine unabhängige Demokratie-Kommission, besetzt mit Juristen, Technikern und (nicht gekauften) Bürgervertretern, erhält Einsicht in Entwürfe vor ihrer offiziellen Freigabe.
Die Aufgabe: Frühwarnung. Wenn sich ideologische Schieflagen, Lobbyeinflüsse oder GONGO-Verstrickungen zeigen, wird das öffentlich gemacht. Nicht als Skandal, sondern als strukturierter Mechanismus, der Vertrauen schafft. Ein demokratisches Audit, das genauso selbstverständlich sein sollte wie eine Finanzprüfung.
- Internationale Einsätze nur mit Transparenz & Cooling-off
Die Praxis ist bekannt, aber kaum reguliert: Verwaltungsbeamte wechseln für ein paar Jahre zur WHO, zur OECD, zur UNO-Gremien oder Big Pharma und kehren dann zurück in die Bundesverwaltung. Problem: Sie bringen nicht nur Know-how mit, sondern auch verinnerlichte Agenden, neue Loyalitäten und ein starkes Interesse, die in Genf oder Brüssel gesetzten Linien auch in der Schweiz umzusetzen.
Deshalb gilt künftig: Jeder dieser Einsätze muss
a) öffentlich genehmigt,
b) vollständig offengelegt und
c) durch eine verpflichtende Übergangsfrist (Cooling-off) abgesichert werden.
Kein nahtloser Rücktransfer in sensible Dossiers. Kein EU-Vorposten mit Schweizer Pass.
- Bürgerrecht auf Akteneinsicht bei internationalen Verträgen
WHO-Verträge, digitale IDs, Finanzabkommen: sie alle werden häufig ausserhalb der politischen Öffentlichkeit vorbereitet. Die entscheidenden Dokumente entstehen in Arbeitsgruppen, Taskforces oder internationalen Foren, zu denen weder Parlament noch Bürger regulären Zugang haben.
Deshalb fordern wir: ein rechtlich verankertes Akteneinsichtsrecht für Bürgerinitiativen und Medien bei internationalen Vertragsverhandlungen. Transparenz nicht nur nachträglich, sondern schon im Entstehen.
Denn Demokratie ist nicht nur eine Frage von Abstimmungen. Sie ist auch eine Frage der institutionellen Hygiene. Und die beginnt dort, wo Macht zu lange unbeobachtet bleibt. Wer den Filz verhindern will, muss rotieren. Good Practice – jetzt auch für Bern.
Den Filz beseitigen – aber richtig
Wer den Bundesrat austauschen will, kratzt an der Fassade. Wer den Filz beseitigen will, muss den Druck auf die Verwaltung erhöhen. Und zwar dort, wo die Macht wirklich sitzt: bei den Staatssekretären und ihren loyalen Seilschaften.
Wenn Demokratie wieder heissen soll, dass das Volk entscheidet, müssen wir beginnen, die Macht hinter der Macht offenzulegen. Nicht halbherzig, nicht symbolisch, sondern mit System. Nur wer den Apparat durchleuchtet, kann ihn auch bändigen. Und nur wer ihn bändigt, kann das politische Steuer wieder in die Hand des Souveräns legen.
Denn solange Technokraten das Drehbuch schreiben und Politiker es nur noch ablesen, ist der Volkswille nur noch Bühnenbild. Die Demokratie wird nicht an der Urne verteidigt – sondern im Maschinenraum der Macht zurückerobert.
Und jetzt? Was wir tun können – konkret.
Wir haben verstanden, wo die wahre Macht sitzt. Jetzt müssen wir sie in Bewegung bringen:
- Transparenz fordern.
Jeder Bürger hat das Recht zu wissen, wer in seinem Namen Verträge verhandelt, Richtlinien schreibt und Budgets verteilt. Fragen Sie Ihre Parlamentarier – öffentlich. - Rotation jetzt!
Fordern wir ein Verwaltungs-Rotationsmodell: Alle 4 Jahre in ein neues Departement. Alle 4 Jahre auf den Prüfstand. Keine Macht auf Lebenszeit. - Bürgerrecht auf Einsicht.
Vertragsentwürfe, Gremienprotokolle, externe Mandate: öffentlich einsehbar, bevor sie durchgewunken werden. - NGO-Finanzierung offenlegen.
Wer zahlt die GONGOs? Wer bestimmt die Agenda im Hintergrund? Wir wollen Namen, Zahlen, Zeitpunkte. - Abschaffung der Schattenämter.
Kein „Sonderbeauftragter“, keine „Plattform“, kein „Koordinator“ ohne klare demokratische Kontrolle. - Verfassungs-Update für den Verwaltungsstaat.
Die direkte Demokratie braucht ein Immunsystem gegen Machtverschiebung. Warum? Weil unsere Verfassung davon ausgeht, dass gewählte Politiker regieren. Weil es keine effektiven Mechanismen zur Kontrolle der Verwaltung gibt. Weil zentrale Prozesse wie die Ausarbeitung internationaler Verträge systematisch an der Demokratie vorbeilaufen. Weil NGOs, Thinktanks und „externe Berater“ über Milliardengelder mitentscheiden, ohne Legitimation. Weil unsere Demokratie sonst zur Fassade verkommt. Der Verwaltungsstaat ist längst nicht mehr neutraler Vollzugsapparat, sondern Akteur. Das muss die Verfassung anerkennen und regulieren.


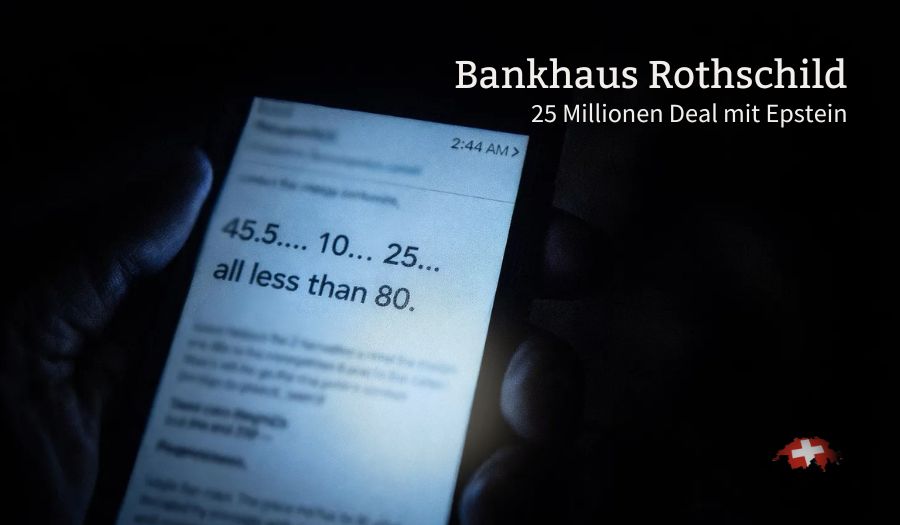







0 Comments