Zivilfaschismus im Sonntagsformat
Wie Telebasel das Denken rahmt
Die E-ID ist ein Paradebeispiel für die unsichtbaren Waffen der Propaganda: Ein nüchternes Verwaltungsprojekt wird in ein moralisches Schlachtfeld verwandelt. Wer dagegen ist, hat angeblich Angst, sei lächerlich oder gar ein Staatsfeind. Das zeigte sich jüngst im Telebasel-Sonntagstalk (14.09.2025: e-id, frühfranzösisch, ps-beschränkung), wo drei Jungpolitiker die Klingen kreuzten. Doch der eigentliche Schlagabtausch fand nicht zwischen SVP, Juso und GLP statt, er spielte sich auf der Metaebene ab: im Framing.
Framing als Waffe
Framing bedeutet, einen Deutungsrahmen zu setzen, in dem Fakten und Meinungen erscheinen. Dieselben Worte können Vertrauen wecken oder Angst erzeugen, je nachdem, wie man sie in Szene setzt. Die Linke hat dieses Handwerk perfektioniert. Sie weiss: Wer die Sprache kontrolliert, kontrolliert das Denken. Telebasel demonstrierte dies exemplarisch. Ein Sonntagstalk als Schaubühne für Sprachpolitik.
- Kritik = Angst: Sascha Müller (JSVP) sprach über Überwachung, Datenmissbrauch, Verlust der Freiheit. Seine Argumente sind rational und nachvollziehbar. Doch Telebasel rahmt („framen“) sie als Misstrauen, als Rückständigkeit, als lächerliche Angst. Der Zuschauer lernt: Wer skeptisch ist, ist altmodisch, ängstlich und im Kern irrational.
- Befürwortung = Fortschritt: Juso und GLP dagegen dürfen glänzen mit Zukunft, Vertrauen, Modernität. Ihre Worte: Chancen, Sicherheit, Konkurrenzfähigkeit. Der Zuschauer soll fühlen: Wer für die E-ID ist, ist gebildet, jung, weltoffen und zukunftsorientiert. Wer dagegen ist, wirkt wie ein Miesepeter, der die Uhr zurückdrehen will.
- Der Joker: Am Ende setzt die Redaktion den ultimativen Frame: Gegner stammen angeblich aus dem rechtsextremen Milieu. Fertig. Stempel drauf. Diskussion beendet. Die Botschaft ist klar: Kritik an der E-ID = Nähe zu Extremisten. Wer will da noch ernsthaft widersprechen?
Diese Dreiteilung funktioniert wie ein psychologisches Korsett. Dem Zuschauer wird subtil vermittelt: Es gibt eine richtige Seite (Vertrauen, Fortschritt) und eine falsche (Angst, Rechtsextremismus). Dazwischen existiert nichts. Und wer nicht klar auf der „richtigen“ Seite steht, rutscht automatisch ins Lager der Verdächtigen. Das ist kein Diskurs, das ist Dressur durch Sprache.
Die linke Technik: Schuld durch Nähe
Wer dieselbe Meinung hat wie ein angeblich „Rechter“ oder „Systemgegner“, wird sofort mit ihm gleichgesetzt. Das ist klassische Schuld durch Assoziation. Kritiker werden nicht inhaltlich widerlegt, sondern moralisch kontaminiert. Ein SVP-Argument? Sofort „rechtsextrem“. Ein Einwand gegen Überwachung? Schon „Staatsverweigerung“. Skepsis gegenüber einem Medikament? Zack: „Impfgegner“. Ein Zweifel an der Klimapolitik? Schon steckt man im Sack „Klimaleugner“. Wer auch nur einen Schritt zur Seite macht, abseits der offiziellen Linie, wird sofort mit der grössten denkbaren Schande gebrandmarkt.
Diese Technik funktioniert so perfide, weil sie keine Inhalte braucht. Sie lebt allein von der Angst vor sozialer Ächtung. Niemand möchte als „Nazi“ oder „Gefährder“ gelten, also halten viele den Mund, selbst wenn sie gute Argumente hätten. Damit wird nicht nur die Debatte vergiftet, sondern jede Kritik im Keim erstickt. Das Ergebnis: ein Klima der Selbstzensur, in dem sich nur noch diejenigen äussern, die brav im Chor mitsingen.
Die Assoziationskette ist immer dieselbe: Zweifel = Nähe zu „Rechten“ = Nähe zu „Gefahr“ = moralisch erledigt. Das spart der Linken jede echte Auseinandersetzung. Denn wer möchte schon in einem Atemzug mit Neonazis, „Querdenkern“ oder Staatsfeinden genannt werden? Genau darauf zielt die Methode: nicht überzeugen, sondern beschmutzen.
Und der stärkste Knüppel in diesem Arsenal ist der Antisemitismus-Vorwurf. Wer in keinem anderen Frame mehr passt, bekommt das ultimative Etikett: Antisemit. Das ist der Totschläger schlechthin, der jede Debatte beendet, bevor sie überhaupt beginnen kann. Einmal ausgesprochen, bleibt der Makel hängen, egal wie unbegründet er ist. Damit lässt sich jede kritische Stimme mundtot machen und genau deshalb ist dieser Vorwurf so beliebt bei jenen, die keine Argumente mehr haben.
Zivilfaschismus: Der moralische Pranger
Immer dann, wenn keine sachlichen Argumente mehr greifen, springen die moralischen Frames ein. Dann ist man:
- Nazi
- Staatsverweigerer
- Coronaleugner
- Klimaleugner
- Impfgegner
- Antisemit
Kurz: ein nicht-systemtreues Arschloch. Und genau hier zeigt sich, was wir Zivilfaschismus nennen: nicht der offene Terror des Staates, sondern die subtile, gesellschaftlich akzeptierte Ächtung des Abweichlers. Kein Schiessbefehl, sondern Sprachbefehle. Kein Staatsterror, sondern gesellschaftliche Brandmarkung. Zivilfaschismus bedeutet: die Herrschaft der moralischen Etiketten. Wer nicht gehorcht, verliert nicht die Freiheit durch Gefängnis, sondern durch Ausschluss aus Diskurs und Gemeinschaft.
Zivilfaschismus funktioniert über moralische Pranger. Man braucht keine Polizei, wenn die Nachbarn schon denunzieren. Man braucht keine Zensurbehörde, wenn Redaktionen, Talkshows und Social-Media-Mobs zuverlässig jeden Kritiker öffentlich zerlegen. Die Botschaft lautet: Wer ausschert, verliert Ansehen, Job, Freundeskreis. Genau darin liegt die Macht: nicht in Gewalt, sondern in Ausgrenzung.
So wird jede abweichende Stimme zur Gefahr erklärt. Nicht für den Staat, sondern für die Gemeinschaft. Und wer möchte schon als Gefahr für „die Gesellschaft“ gelten? Der Druck, brav mitzusingen, ist enorm. Es ist die gleiche Mechanik, die man früher bei autoritären Regimen sah, nur dass heute niemand verhaftet wird.
Stattdessen wird man gecancelt, medial vernichtet, moralisch hingerichtet. Der Effekt ist derselbe: Schweigen im Publikum, Konformität auf der Bühne. Genau das ist Zivilfaschismus im 21. Jahrhundert.
Linke Soft Power = kognitive Kriegsführung
Das Ganze ist kein Zufall, sondern eine Technik. Jonas Tögel nennt es kognitive Kriegsführung: Manipulation, die direkt ins Unterbewusstsein zielt. Nudging, Framing, moralische Keulen. Alles Methoden, die nicht überzeugen, sondern dressieren. Und die Linke setzt diese Methoden systematisch ein. Warum? Weil sie ohne diese Instrumente oft keine Argumente mehr hat. Wo die Fakten nicht reichen, hilft die moralische Keule:
- Widerspruch wird nicht widerlegt, sondern pathologisiert.
- Wer Kritik äussert, wird zum „Gefährder“ erklärt.
- Wer nicht mitsingt im Chor der systemtreuen Gesinnung, landet auf der Liste der Verdächtigen.
Diese Strategie hat sich längst verselbständigt. Sie ist nicht mehr nur ein rhetorischer Trick, sondern eine gesamte politische Kultur. Eine Kultur, die weniger auf Dialog setzt als auf Disziplinierung. Linke Soft Power ist nichts anderes als Dressur. Das Publikum soll reagieren wie der Pawlowsche Hund: Signal hören, sofort moralisch gehorchen.
Man muss verstehen: Diese Methoden zielen nicht auf den Verstand, sondern auf das Bauchgefühl. Wer ständig mit Schlagworten wie „Gefahr“, „Solidarität“, „Zukunft“ oder „Menschenfeindlichkeit“ bombardiert wird, beginnt unbewusst, diese Frames als Realität zu akzeptieren. So wird die Bevölkerung nicht überzeugt, sondern programmiert.
Die Linke hat aus Debatte ein Tribunal gemacht. Sie setzt Sprache ein wie eine Waffe. Wer nicht pariert, wird gebrandmarkt. Und jeder, der es wagt, die Spielregeln zu hinterfragen, erlebt sofort die volle Wucht des Apparats: erst das Stigma, dann die Ausgrenzung. Genau so funktioniert kognitive Kriegsführung: leise, subtil, aber gnadenlos effektiv.
Das Ergebnis: Meinungsdressur statt Debatte
Die Bevölkerung wird nicht mehr aufgeklärt, sondern erzogen. Das ist kein journalistischer Diskurs mehr, das ist Sozialtechnik. Telebasel ist nur ein Symptom. Doch der Apparat funktioniert schweizweit gleich: SRF, Blick, Tamedia (Tages-Anzeiger, Bund, Berner Zeitung, Basler Zeitung) und CH Media (Aargauer Zeitung, Luzerner Zeitung, St. Galler Tagblatt) bedienen sich der gleichen Vokabeln, als hätte jemand das Memo verschickt. Selbst die NZZ, die sich gern als liberal-konservativer Gegenpol inszeniert, übernimmt in kritischen Momenten die vorgegebenen Frames, nur eben eleganter verpackt.
Die Ironie: Gerade die, die am lautesten vor „Faschismus“ warnen, praktizieren ihn in der subtilsten Form. Nicht mit Stiefeln und Knüppeln, sondern mit Mikrofonen und Talkshows.
Wie konnte es dazu kommen?
Die entscheidende Frage lautet: Wie konnte es so weit kommen, dass in der Schweiz ausgerechnet jene, die vor Faschismus warnen, ihn selbst in zivilisierter Verpackung betreiben? Die Antwort führt zurück in die ideologischen Werkstätten der letzten Jahrzehnte. Ein Mix aus 68er-Kulturrevolution, linksdominierten Universitäten und global finanzierten NGOs hat die intellektuelle Deutungshoheit gekapert. Dort wurde trainiert, wie man Sprache umcodiert, wie man Diskurse verschiebt, wie man Gegner moralisch erledigt. Diese Kader sitzen heute in Redaktionen, Stiftungen und Parteizentralen. Und sie bedienen sich derselben Rezepte: Schuld durch Nähe, Cancel Culture, moralische Keulen.
Was wir erleben, ist nicht Zufall, sondern das Resultat eines langfristigen Marschs durch die Institutionen. Die Linke hat es geschafft, die Hebel der Soft Power zu besetzen: von der Uni über die NGO bis ins Studio von SRF. Dort werden die Narrative gebaut, die dann die ganze Bevölkerung konditionieren. Es ist ein Ökosystem, in dem sich Politik, Medien und Aktivismus gegenseitig bestätigen und jede abweichende Stimme wird mit der gleichen Waffe erledigt: der moralischen Ausgrenzung.
Hat das keiner gemerkt?
Natürlich haben es viele gemerkt, aber kaum jemand wollte es beim Namen nennen. Die einen, vor allem Politiker und Journalisten, haben es nicht gemerkt, weil sie selbst längst Teil des Apparats geworden sind. Sie hielten ihre Fortschrittsrhetorik für Aufklärung und bemerkten nicht, dass sie Dressur betrieben. Andere haben es sehr wohl erkannt, aber geschwiegen, aus Angst vor Stigmatisierung: Niemand will als Nazi, Coronaleugner, Klimaleugner oder Antisemit abgestempelt werden. Das Framing-System erzeugt ein Klima der Angst und damit wirksame Selbstzensur.
Die breite Masse wiederum spürt zwar instinktiv, dass etwas faul ist, doch die permanente Sprachdusche aus SRF, Blick, Tamedia und Co. macht es schwer, die Mechanik dahinter klar zu sehen. Das Perfide daran: Das System tarnt sich als „Demokratieverteidigung“. Wer es kritisiert, wirkt automatisch wie ein Feind der Demokratie. So konnte der Zivilfaschismus wachsen, ohne dass breite Gegenwehr entstand. Weil alle, die etwas sagten, sofort aussortiert wurden. Schweigen wurde zur sichersten Überlebensstrategie.
Was können wir dagegen tun?
Die entscheidende Frage lautet nicht mehr nur: Wie funktioniert das Framing? Sondern: Wie stoppen wir es? Wir dürfen diese wohlstandsverwahrloste Kaste nicht länger gewähren lassen. Eine Schicht von Akademikern, Funktionären und Medienleuten, die nie wirklich etwas leisten musste, sich aber anmasst, uns ihre indoktrinierten Ideologien aufzuzwingen. Sie reden von Solidarität, meinen aber Gehorsam. Sie reden von Fortschritt, meinen aber Kontrolle.
Die Antwort kann nicht länger nur „Aufklärung“ heissen. Der Apparat lacht darüber. Es braucht eine härtere Antwort: Widerstand durch Organisation, durch aktive Gegenmacht, durch den Aufbau eigener Strukturen. Wir müssen die Mechanismen sichtbar machen, die Sprache entgiften und den Mut zurückholen, das Offensichtliche auszusprechen, aber eben nicht mehr allein im stillen Kämmerlein oder auf Nischenkanälen, sondern laut, koordiniert, unübersehbar.
Jeder kann seinen Teil leisten: nicht jeden Frame schlucken, Begriffe hinterfragen, Widerspruch wagen, auch wenn die Keule sofort geschwungen wird. Doch es reicht nicht mehr, nur standzuhalten. Wir müssen offensiv auftreten, die Selbstzensur ablegen und die Gegner blossstellen. Denn Schweigen ist das, was den Zivilfaschismus stark macht. Aber lauter, massenhafter Widerspruch ist das, was ihn bricht.
Konkrete Schritte:
- Eigene Begriffe prägen: Nicht die Frames der Linken übernehmen, sondern unsere eigene Sprache setzen und damit die Deutungshoheit zurückholen.
- Gegenöffentlichkeit stärken: Alternative Medien unterstützen, eigene Plattformen aufbauen, Informationen ohne Filter verbreiten.
- Widerspruch üben: In Gesprächen, auf Podien, in den sozialen Medien. Nicht ducken, sondern pointiert kontern.
- Solidarität nach innen: Wer angegriffen wird, darf nicht alleinstehen. Jede Kampagne gegen Kritiker muss sofort breite Gegenwehr erfahren.
Nur so entsteht eine Gegenmacht, die stark genug ist, das Framing zu durchbrechen und die Sprachherrschaft zurückzuerobern.
Wir brauchen eine Gegenöffentlichkeit, die unerschrocken ist. Medien, die nicht nach der gleichen Sprachregelung tanzen. Bürger, die sich nicht dressieren lassen. Und eine klare Ansage an jene, die glauben, uns erziehen zu können: Eure Zeit ist vorbei. Demokratie lebt nicht von betreuten Gedanken, sondern von freiem Streit. Wer das nicht aushält, hat im öffentlichen Diskurs nichts verloren.
Und eines muss klar sein: Die vermeintliche intellektuelle Elite der Linken ist in Wahrheit oft erstaunlich blank. Schlagworte statt Substanz, Emotion statt Argument. Wer ihnen ernsthaft widerspricht, merkt schnell, wie dünn die Decke ist. Darum ist es unsere Aufgabe, den Vorhang zu lüften und zu zeigen: Der Kaiser ist nackt. Sobald das Offensichtliche laut ausgesprochen wird, bricht die ganze Inszenierung zusammen, weil sie nie auf Stärke gebaut war, sondern nur auf Angst und Schweigen.

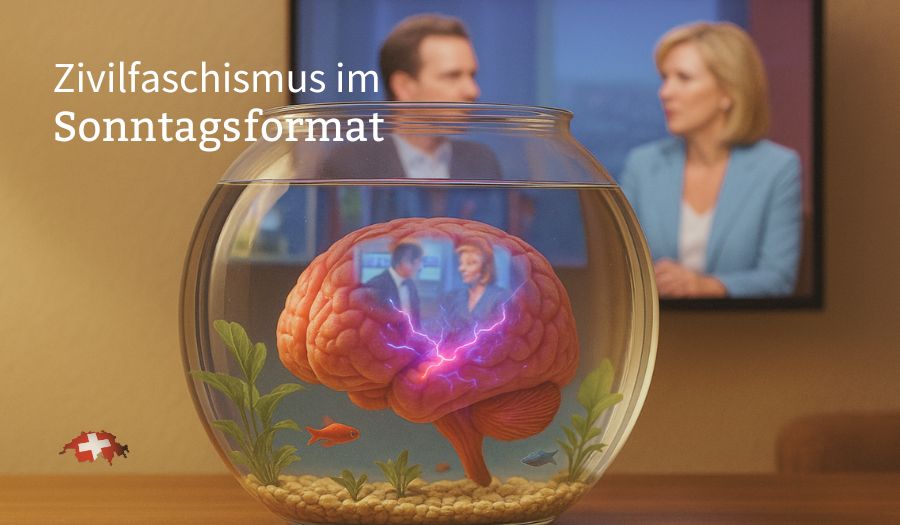

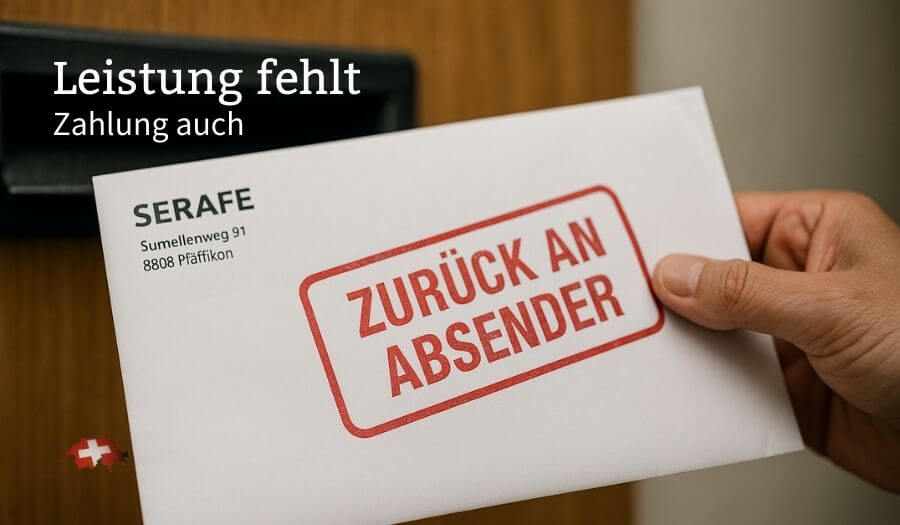






0 Comments