Weggeputscht
Eine demokratische Verlustanzeige
Achtung: Dieses Essay könnte Ihre Vorstellung von Freiheit beschädigen
Vorwort: Protokoll eines schleichenden Abschieds
Tellistan, früher ein Labor direkter Demokratie. Heute ein Satellit globaler Gremien. Der Staatsstreich kam nicht mit Panzern – sondern mit Verordnungen, Protokollen und einem Lächeln.
Es war kein Umbruch, sondern ein allmähliches Wegfallen der Widerstände. Keine Gewalt, keine Helme, keine Jubelschreie – nur das Klicken von PowerPoint-Folien und das Schweigen der Medien. Man dachte, alles sei in Ordnung, weil man noch wählen durfte. Aber man wählte längst nur noch zwischen Varianten derselben Abhängigkeit.
Dieses Essay ist kein Aufruf. Es ist auch keine Abrechnung. Es ist ein Bericht aus einem Land, das einst wusste, wie Freiheit schmeckt, und jetzt den Unterschied nicht mehr erkennt zwischen Konsens und Kapitulation. Geschrieben aus einer inneren Notwendigkeit heraus und, weil das Schweigen gefährlicher geworden ist als das Sprechen.
Es ist eine Erinnerung für jene, die noch nicht völlig sediert wurden vom bequemen Nebel der Alternativlosigkeit. Es ist ein Seismograph, der ausschlägt, lange nachdem die Erde sich still zu verschieben begann. Es ist ein Weckruf, dessen Lautstärke nicht in Dezibel, sondern in der Tiefe des Unbehagens gemessen wird.
Denn was geschieht mit einem Volk, das die Frage nach seiner Selbstbestimmung auslagert – an Gremien, die es nicht kennt, an Akteure, die es nicht wählen kann, an Prozesse, die nicht mehr hinterfragt werden dürfen? Was geschieht mit einem Land, wenn sein Stolz – jahrhundertelang gebaut auf Eigenständigkeit, Mitsprache, Kontrolle – zu einem dekorativen Aushängeschild verkommt, das niemand mehr ernst nimmt, nicht einmal die Bewohner selbst?
Dieses Essay ist ein Dokument des Übergangs. Von einer Republik zur Replik. Von Freiheit zur Funktion. Von Stimme zu Stille. Es richtet sich an jene, die nicht mehr wissen, was genau fehlt, aber spüren, dass etwas Fundamentales zerbricht.
Und es wird geschrieben, weil man es später nicht mehr wird schreiben dürfen.
Die Stille vor dem Umbruch
Der alte Alois aktualisierte gerade die Gemeinde-App auf seinem Tablet, als das Telefon vibrierte. Keine Nummer angezeigt – nur: „Zentrale Verwaltung – nicht antworten“. Er nahm trotzdem ab. Alte Gewohnheit.
„Alois, das brauchst du nicht mehr“, sagte die Stimme. Ruhig, freundlich, effizient. „Die Abstimmung wurde automatisch übernommen. Synchronisiert mit der regionalen Plattform. Vollharmonisierung, you know. Das regelt Brüssel.“
Alois sagte nichts. Er sah auf das Display, als könne er dort einen anderen Satz erwarten. Irgendeinen Hinweis, dass das nicht endgültig war. Dann legte er das Gerät langsam zur Seite wie ein Relikt aus einer vergangenen Zeit, das plötzlich seine Bedeutung verloren hatte.
Er stand auf, zog sich die winddichte Weste über und trat hinaus. April. Zu still für April. Die Luft roch nach Frühling, aber sie hatte diesen metallischen Unterton, den man nur bemerkt, wenn man lange genug geschwiegen hat.
Die Strasse war leer. Keine Wahlplakate. Kein Sammelstand. Kein einziger Mensch, der diskutierte oder debattierte. Früher standen sie hier, Alois und die anderen, mit Klemmbrettern, Brotdosen und Meinungen. Heute nur eine QR-Tafel am Brunnen mit der Aufschrift: „Information erfolgt digital. Danke für Ihr Vertrauen.“
Die Krähen auf dem Kirchendach flogen tiefer als sonst.
Im Gemeindehaus flackerte Licht, obwohl niemand mehr tagte. Das Protokoll der letzten Gemeindesitzung war auf Englisch verfasst worden. Alois hatte es gelesen. Oder versucht. Begriffe wie „Compliance“, „Stakeholder Alignment“, „Public Health Readiness“ schienen mehr über die neue Welt zu sagen als alles, was er in seiner alten Handbibliothek finden konnte.
Er setzte sich auf die Bank beim Denkmal. Die Inschrift verblasst. „Die Stimme des Volkes wiegt schwerer als der Wille des Fürsten.“ Ein Satz, der einmal Mut gemacht hatte. Jetzt klang er wie aus einer Zeit, in der Menschen sich noch zuständig fühlten.
Ein junger Mann kam vorbei, starrte auf sein Smartwatch-Display, blieb stehen, scrollte, verzog keine Miene, ging weiter. Vielleicht hatte er gerade abgestimmt. Vielleicht hatte er gerade einer neuen Verordnung zugestimmt, ohne es zu merken. Vielleicht war das die Zukunft: Entscheidungen ohne Bewusstsein. Mitsprache ohne Gedanken. Teilhabe als Opt-in-Funktion.
Alois lehnte sich zurück, schloss die Augen. Ein leiser Wind zog durch die Gasse. Früher hätte er gespürt, dass etwas im Umbruch war. Heute war er sich nicht mehr sicher, ob das Unbehagen noch real war oder nur ein Echo aus einer anderen Zeit.
Er erinnerte sich an den Satz, den er einmal bei einer Gemeindeversammlung aufgeschnappt hatte:
„Wenn die Menschen glauben, dass sie noch etwas zu sagen haben, wird man ihnen alles nehmen können.“
Jetzt verstand er ihn.
Tellistan: Ein Land kapituliert – nicht durch Zwang, sondern durch Zustimmung
Tellistan – benannt nach jenem legendären Armbrustschützen, der einst einem Tyrannen die Stirn bot. Heute trüge er wohl Maske, QR-Code und käme nur mit WHO-Genehmigung ins Rathaus.
Was man früher als Bürgerpflicht begriff, wurde nun zur nostalgischen Folklore. Abstimmen, mitreden, hinterfragen – das war einmal gelebte Kultur, heute ist es ein verstaubtes Ritual. Die Urne steht noch da, in der Vitrine des Gemeindemuseums, mit einem erklärenden Schild daneben: „Original-Stimmkasten der direkten Demokratie – frühes 21. Jahrhundert.“ Besucher drücken sich die Nase an der Scheibe platt. Manche lächeln mitleidig. Andere fotografieren sie wie ein Artefakt aus einer versunkenen Zivilisation.
Der Volkswille schrumpfte zur Erinnerungsfigur, wie eine Statue auf dem Dorfplatz – ehrwürdig, aber machtlos. Man putzt sie noch regelmässig, legt an Feiertagen Blumen nieder. Doch sie ist verstummt. Niemand hört mehr hin, wenn der Wind ihre Konturen umspielt. Sie ist da, aber ohne Funktion. Ein Symbol, das nicht mehr wirkt – wie ein Kompass im Fahrstuhl.
Einmal war Tellistan ein Licht inmitten Europas. Eine Bastion des Eigenwillens. Stolz auf seine Unabhängigkeit, auf seine Sperrigkeit, auf seine bürgerliche Beharrlichkeit. Es war ein Land, das sich lieber stritt, als zu gehorchen. Das lieber langsam war, aber selbstbestimmt. Das Prinzip: Wahrheit wird nicht geliefert, sondern erkämpft – in hitzigen Versammlungen, auf Marktplätzen, am Familientisch. Jeder war zuständig. Jeder war Teil des Experiments.
Heute sitzt Tellistan in Kommissionen und nickt. Es diskutiert nicht mehr, es übernimmt. Es beruft sich auf „internationale Standards“, „globales Alignment“, „Good Governance“. Die Sprache klingt klug, aber sie blendet. Denn was übersetzt wird, ist nicht Einsicht, sondern Anpassung. Man nennt es Fortschritt – aber es ist Einordnung. Man nennt es Verantwortung – aber es ist Unterwerfung.
Früher fragte man: „Wie wollen wir leben?“
Heute fragt man: „Ist das konform mit den Guidelines?“
Tellistan hat sich nicht verkauft. Es hat sich eingeliefert. In eine Welt der Alternativlosigkeiten. In ein Netz von Verpflichtungen, das so fein gesponnen ist, dass es keiner mehr sieht – aber jeder spürt.
Und während draussen der Verkehr rollt und die Cafés voll sind, bleibt drinnen ein Vakuum zurück. Dort, wo einmal Demokratie war. Etwas fehlt. Nicht laut. Nicht offensichtlich. Aber grundlegend.
Man nahm uns nicht die Freiheit. Man hat uns höflich davon entbunden.
Verwaltungsakt: Staatsstreich
Der Staatsstreich in Tellistan war kein Event. Er war ein Verwaltungsakt. Kein Knall, kein Chaos, keine Panzer vor dem Parlament. Stattdessen: Memos. Sitzungen. Empfehlungen. Und ein allmähliches Abgleiten in eine neue Normalität, die so effizient verpackt war, dass kaum jemand sie bemerkte.
Er kam nicht über Nacht, sondern über Jahre. Und er wirkte nicht schockierend – sondern alternativlos. Ein leiser Umbau, Schicht um Schicht. Immer begründet. Immer sachlich. Immer technisch. Der Widerstand verkümmerte nicht aus Feigheit, sondern aus Überforderung.
Die Werkzeuge waren unscheinbar: Gremien, Protokolle, international abgestimmte Formulierungen. Was einmal „souveräne Entscheidung“ hiess, wurde zu „technischer Anpassung“. Der Begriff „Opting-Out“ wurde behandelt wie eine infektiöse Idee, die man möglichst nicht verbreiten sollte, als drohe allein durch ihre Nennung ein Rückfall in die Steinzeit der Eigenverantwortung.
Das Parlament wurde höflich ignoriert. Die Kommissionen informiert, aber nicht eingebunden. Die Bevölkerung nicht einmal belogen, sondern einfach übergangen. Der Trick war nicht die Lüge, sondern der Vollzug in Abwesenheit jeglicher politischer Reibung. Eine neue Kultur der Reibungslosigkeit hatte sich etabliert. Politik als Maintenance. Demokratie als Betriebsmodus.
Die Realität? Zu komplex für eine Headline
Einige Nationalräte ahnten es. Manche gaben Interviews. Aber niemand hörte zu. Denn die Realität war zu komplex für eine Headline. Und die Kritik zu unbequem für den Zeitgeist. Es war leichter, über Klimaziele und Gendergerechtigkeit zu diskutieren als über Machtverschiebungen ohne Mandat.
In den Sitzungsprotokollen tauchten Formulierungen auf wie: „im Hinblick auf internationale Übereinkünfte“, „zur Gewährleistung globaler Anschlussfähigkeit“ oder „gemäss Empfehlungen multilateraler Organisationen“. So wurde die Wahrheit verpackt – steril, geschliffen, unverfänglich. Und genau darin lag ihre Gefährlichkeit.
Denn wer kritisierte, wurde nicht widerlegt, sondern abgewertet. Als rückständig. Als unkooperativ. Als Gefahr für Tellistans Ruf als „verlässlicher Partner“. Es brauchte keine Zensur im alten Sinn. Die neue war smarter. Sie funktionierte sozial – über Codes, Karrieren, Konferenzeinladungen. Man lächelte, man bedankte sich fürs Feedback, man versprach Prüfung – und schob es ins Archiv. Kritik wurde nicht bekämpft. Sie wurde delegitimiert. Nicht mit Argumenten, sondern mit Attitüde.
So verstummte der Zweifel nicht durch Repression, sondern durch Ritual. Es brauchte keine Zensur, nur gute Manieren. Kein Verbot, nur das richtige Wording. Die Abrüstung der Debatte geschah höflich, korrekt – und tödlich für jeden Gedanken, der aus der Reihe tanzte.
Selbst in den Medien herrschte keine Zensur. Sie war schlicht unnötig. Die freiwillige Disziplin übertraf jede staatliche Massnahme – aus Überzeugung, aus Karrieresinn, aus dem Wunsch, auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen. Redaktionen übernahmen die Sprachregelungen internationaler Organisationen nicht nur – sie adaptierten sie mit Begeisterung. Was früher als PR galt, wurde zur redaktionellen Linie.
Glänzen in der internationalen Echokammer
Man wollte nicht nur anschlussfähig bleiben. Man wollte dazugehören. Mitdenken. Mitgestalten. Man wollte glänzen in der internationalen Echokammer, als mediale Partnerinstitution im Kampf gegen „Desinformation“, „Abweichung“ und andere Relikte einer unangenehm pluralistischen Vergangenheit.
Nachfragen galten als altmodisch. Kritik als toxisch. Und wer trotzdem nachbohrte, musste damit rechnen, aus dem Zirkel des Vernünftigen ausgeschlossen zu werden. Nicht offiziell, aber spürbar. Der Zeitgeist hatte Hausrecht.
Ganze Generationen wuchsen auf, ohne je zu erleben, wie sich echte Selbstermächtigung anfühlt. Sie hielten Partizipation für ein Emoji unter einer Regierungsstory und verwechselten Zustimmung mit Interaktion. Sie kannten nur Feedbackrunden mit Muffins, Stakeholder-Dialoge mit Namensschildern und Policy Papiere mit mehr Anglizismen als Argumenten.
Was früher als Bürgerpflicht galt, wurde zu einem Klick auf „Teilgenommen“ in einem Online-Formular, gefolgt von einem automatischen Dankeschön und einem Link zu den FAQ. Beteiligung war jetzt UX-optimiert. Niemand störte sich daran, dass Entscheidungen längst woanders getroffen wurden. Hauptsache, man fühlte sich einbezogen. Und weil keiner mehr wusste, wie Widerstand eigentlich geht, nannten sie es „Kollaboration“ und dachten, das sei der Fortschritt.
Es stand nie zur Debatte
Und als der Umbruch schliesslich vollzogen war, konnte niemand mehr sagen, wann genau es passiert war. Nicht, weil es geheim gewesen wäre, sondern weil es niemand interessiert hatte. Es stand nie zur Abstimmung. Es stand nie zur Debatte. Es wurde einfach eingeführt. Still. Akribisch. Als Fortschritt verpackt und als Notwendigkeit verkauft.
Es war geschehen wie ein automatisches Software-Update: Man klickte auf „Akzeptieren“, ohne zu lesen, worum es ging und redete sich ein, das werde schon richtig sein. Abends wusste keiner mehr, dass es passiert war. Aber es war passiert. Und zwar gründlich.
Der Putsch war kein Spektakel. Kein Drama. Kein Helikopter auf dem Dach. Er war ein Fortschrittsprotokoll. Ein PDF mit der Fussnote „bereits in Umsetzung“. Ein „technischer Schritt“ im Namen der internationalen Kohärenz.
Und Tellistan? Tellistan hatte es brav abgenickt. Mit einem digitalen Häkchen unter der Rubrik „Ich stimme zu“ – und einem Latte Macchiato in der Hand.
Der neue Glaube – Technokratie als Religion
In Tellistan musste niemand mehr glauben. Es genügte, sich zu beugen. Die Technokratie war keine Ideologie. Sie war ein Betriebssystem. Unsichtbar. Unwählbar. Aber total. Wer dazugehören wollte, musste updaten. Wer nicht mitkam, war bald ein Kompatibilitätsproblem.
WHO, UNO, EU, WEF, GAVI – es war wie ein internationales Priesterkollegium, das in abgeschotteten Räumen neue Heilige Schriften verfasste. Sie hiessen „Internationale Gesundheitsvorschriften“, „Pandemievertrag“ oder „dynamische Rechtsübernahme“. Das klang nach Verwaltung, nach Pflichtlektüre für Juristen. Aber diese Texte waren etwas anderes: global kodifizierte Gehorsamsformulare.
Sie hatten keine Seele, aber Wirkung. Sie waren nicht demokratisch beschlossen, aber rechtlich bindend. Ihre Macht lag in der Sprache – dieser neuen, künstlich entpolitisierten Sprache, die alles politisch Wirksame wie einen Staubfilm überdeckte. Begriffe wie „nichtdiskriminierender Zugang“, „verpflichtende Informationsströme“ oder „Vermeidung regulatorischer Fragmentierung“ klangen beruhigend, fast einschläfernd. Doch hinter dieser Syntax steckte nichts Geringeres als die Entmachtung des Nationalen.
Und mit ihm: die Entmachtung des Volkes. Denn was Tellistan einmal ausgemacht hatte, das Prinzip, dass jede Macht vom Volk ausgeht, wurde ersetzt durch ein neues Dogma: dass jede Macht vom Konsens der Funktionäre ausgeht. Ohne Gesichter. Ohne Haftung. Ohne Widerspruch.
Die neuen Sakramente
Die neuen Sakramente waren QR-Codes, digitale Zertifikate, global vernetzte „Trust Frameworks“. Die neuen Prozessionen hiessen „Harmonisierung“, „Alignment“, „Implementation Pathways“. Wer sich verweigerte, verlor den Zugang – nicht nur zu Gebäuden, sondern zu Diskurs, Teilhabe und irgendwann zu seiner eigenen Akte.
Die neuen Inquisitoren sassen in Task Forces und Ethikkommissionen. Ihre Waffe war die Modellrechnung. Ihre Bibel war das Policy Paper. Und ihr Katechismus bestand aus Excel-Dateien, deren Zellen das Leben regelten. Das Ergebnis galt als wissenschaftlich. Und deshalb als unantastbar.
Was früher Religionen vorbehalten war – Wahrheit ohne Beweis – übernahm nun der Apparat. Er forderte keinen Glauben. Er versprach Sicherheit. Und im Gegenzug nahm er sich das, was er „Souveränität“ nannte – ein Wort, das bald aus den Suchmaschinen verschwand.
In Tellistan fragte niemand mehr: „Wer hat das entschieden?“ Die korrektere Frage lautete nun: „Wurde es international abgestimmt?“
Und mit jedem Protokoll, das unterschrieben wurde, mit jeder „technischen Anpassung“, die durchging, mit jeder Pressemitteilung, die ohne Nachfragen zitiert wurde, starb ein Stück dessen, was einmal das Herz von Tellistan gewesen war: Die Möglichkeit, nein zu sagen.
Die Simulation der Mitsprache
Man liess das Volk noch abstimmen, aber nicht mehr über das Wesentliche. Über Parkzonen, Steuerabzüge und die Hundeverordnung durfte man weiterhin entscheiden. Alles andere war „zu komplex“. Die grossen Weichenstellungen liefen an der Urne vorbei – versteckt in multilateralen Memoranden, Policy-Mosaiken und Verwaltungsakten, die nie jemand gelesen hatte, aber alle betrafen.
Der öffentliche Diskurs war nicht mehr öffentlich, sondern kuratiert. Er wurde ersetzt durch Framing-Kampagnen und „Vertrauenskommunikation“. Medienhäuser übernahmen Rollen, keine Fragen. Man inszenierte Dialog, aber man lieferte Inhalte. Debatte wurde zur Choreografie – wohltemperiert, meinungskorrigiert und anschlussfähig.
Die Demokratie war nicht abgeschafft. Sie war ausgelagert. Nach Genf, nach Brüssel, in die Hinterzimmer einer Verwaltung, die ihre eigene Legitimität längst nicht mehr aus dem Volk bezog, sondern aus der Notwendigkeit. Und Notwendigkeit war das neue Argument. Ein Totschlagargument.
Notwendigkeit fragt nicht. Sie erklärt. Sie verkündet. Sie duldet keinen Widerspruch. Und sie kommt nie allein. Immer im Gepäck: ein Zeitdruck, ein internationales Abkommen, eine neue Bedrohungslage. Wer widersprach, wurde zum „Störer“ erklärt oder zur Fussnote einer Fussnote. Man konnte sich äussern, ja. Aber nicht wirksam.
In der Regierung sprach man von „dynamischer Demokratie“, von „nachgelagertem Mitspracherecht“, von „bürgerzentrierter Umsetzung“. Alles Worte, hinter denen sich dasselbe Prinzip verbarg: Akzeptanzmanagement statt Willensbildung.
Tellistan, einst Paradebeispiel für direkte Mitbestimmung, wurde umfunktioniert zur Durchleitungsstelle globaler Normen. Man nannte es „Verantwortung“. Gemeint war: Fügsamkeit. Tatsächlich war es die stille Kapitulation vor einer neuen Klasse – der Bürokratenelite: unsichtbar, ungewählt, aber allgegenwärtig.
Sie trugen keine Uniformen, sondern ID-Badges. Sie führten keine Befehle aus, sondern „Empfehlungen mit hoher Verbindlichkeit“. Und sie wussten: Je weniger sichtbar ihre Macht war, desto weniger Angriffsfläche bot sie. Demokratie war jetzt eine Fassade mit WLAN.
Und Tellistan nickte. Noch immer. In Sitzungen. In Reports. In den Köpfen. Denn man wollte dazugehören. Um jeden Preis.
Der Putsch war ein Update
Es gab kein Datum. Kein offizielles Memo. Nur eine schleichende Aneinanderreihung von „Reformen“, „Anpassungen“, „Harmonisierungsschritten“.
Die Architektur des Staats war noch da. Aber die Energie war weg. Man hatte das System behalten, aber das Prinzip entsorgt. Wie bei einem Oldtimer, in den man einen Elektromotor pflanzt: aussen gleich, innen ein anderer Geist.
Der Putsch war ein Update. Kein Panzereinmarsch, kein Ausnahmezustand. Niemand wurde verhaftet. Niemand schoss. Niemand schrie. Und genau das machte ihn so perfekt. Er war klinisch. Reibungslos. Alternativlos.
Der Algorithmus hatte übernommen. Die Bürger waren keine Souveräne mehr, sondern Datensätze. Ihre Meinung wurde nicht mehr gehört, sondern modelliert, eingeordnet, gewichtet, absorbiert. Sie flossen in Dashboards ein, nicht in Entscheidungen.
Tellistan war keine Diktatur. Es brauchte keine. Es hatte nur keine Demokratie mehr. Und das reichte. Vollständig.
Man nahm uns nichts – wir gaben es her
Ich sitze auf meinem Balkon. Die Berge sind noch da. Der Himmel auch. Aber es fühlt sich anders an.
Die Luft riecht nach frisch gemähtem Gras, aber nicht nach Zukunft. Die Vögel singen, aber sie stören niemanden mehr – nicht einmal jene, die früher alles kontrollieren wollten. Es ist, als hätten auch sie sich arrangiert. Der Alltag läuft weiter, mit dieser beklemmenden Eleganz, die entsteht, wenn man seine Freiheit nicht mehr vermisst, weil man sie vergessen hat.
Die Menschen reden über das Wetter, über Rezepte, über ihre neuen Wanderschuhe. Sie sagen: „So schlimm ist es doch gar nicht.“ Und sie glauben das wirklich. Vielleicht muss man das auch, um nicht wahnsinnig zu werden. Vielleicht ist Vergessen eine Form von Selbstschutz.
Ich bin kein Bürger mehr. Ich bin Benutzer. Ich darf mich anmelden, einloggen, validieren lassen. Ich darf teilnehmen, aber nicht widersprechen. Ich darf mich äussern, solange ich niemanden störe. Ich darf frei sein, aber bitte nur im Kopf.
Früher sagte man: „Das ist mein Land.“ Heute sagt man: „Das ist das Regelwerk.“ Und irgendwann fragt man sich: Wann genau haben wir aufgehört, Eigentümer zu sein und wurden zu Gästen in der eigenen Geschichte?
Die Verfassung hängt noch im Schulhausflur. Hinter Glas. Staubfrei. Manchmal bleiben Kinder davor stehen, lesen ein paar Sätze, lächeln. Sie halten es für ein Gedicht.
Was geblieben ist, ist die Landschaft. Die Stille am Abend. Die Schatten der alten Bäume, die sich nicht kümmern um Paragraphen. Und vielleicht, ganz vielleicht, auch noch ein Funke in jenen, die sich erinnern, wie es war, bevor man uns weggeputscht hat.
Tellistan ist noch da. Die Berge stehen. Die Rathäuser leuchten. Die Hymne erklingt am Nationalfeiertag.
Aber es gehört nicht mehr uns.
Und das ist das eigentlich Erschütternde:
Nicht, dass man uns etwas genommen hat.
Sondern, dass wir es hergegeben haben.
Freiwillig.
Leise.
Mit einem Nicken.
Und niemand hat „Nein“ gesagt. Nur ein paar haben es gespürt – als es längst zu spät war.
Weggeputscht.


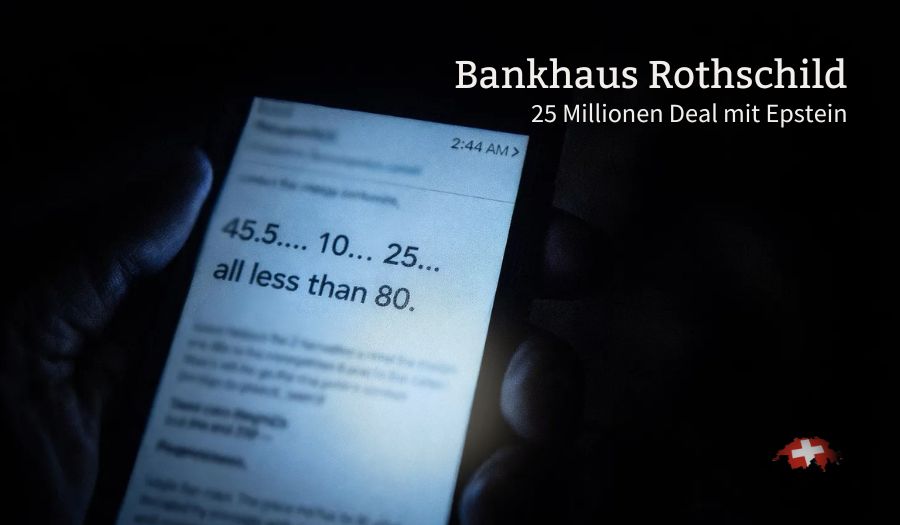







Ein grosses Kompliment und herzlichen Dank für den tiefgründigen Text.
Eine gekonnte, eloquente Schreibweise, mit welcher die grausligen, dramatischen Tatsachen in einer lesefreundlichen Leichtigkeit und mit Witz gespickt geschrieben stehen. Einfach nur Grossartig!
Eure Arbeit ist so, so wichtig, WERTVOLL und von unschätzbarem Wert!
Danke für euer motiviertes Engagement, eure Unermüdlichkeit, eure Weitsicht und Hartnäckigkeit. Danke für all eure „Nägel mit Köpfe“ -Aktionen seit Tagen, Wochen und Jahre.
„Aufgeben ist keine Option“ Danke dass Ihr mir und anderen dies immer wieder vor Augen führt und uns damit stärkt.
DANKE, danke, danke für Euer fulminantes Wirken und wertvolles SEIN
Da gibt es nichts hinzuzufügen!
Danke für dieses Essay. Ein Text, der subtil unter die Haut geht und nachdenklich macht. Sehr geeignet, um ihn an intelligente Menschen zu schicken, die sonst schnell einmal abwinken, wenn sie wieder eine sog. „Verschwörungstheorie“ wittern.